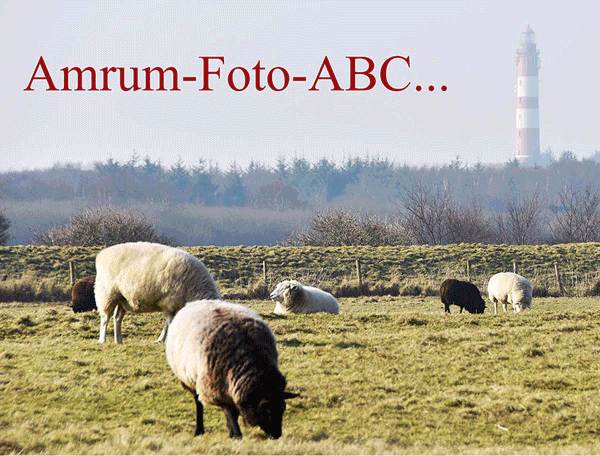Tod auf dem Bahndamm – Hark Petersens dritter Fall
Wasserstoff statt Dieselantrieb, Elektro- statt Ottomotor: Der Ecofare-Konzern will den Verkehr in Deutschland und Europa revolutionieren. Amrum soll dafür sein Musterbeispiel werden. Als auf dem Hindenburgdamm ein Journalist ums Leben kommt, stellt sich für Kommissar Hark Petersen die Frage, ob der Konzern für seine Umwelt-Ziele auch über Leichen geht. Während die Freunde Hochzeit feiern und Amrum bei herrlichstem Wetter genießen, muss Petersen seinen Kurzurlaub immer wieder für Ermittlungen unterbrechen und gerät dabei mehr als einmal in Gefahr. Er hat gefährliche Gegenspieler, deren wahre Motive nur ganz langsam ans Licht kommen.
LESEPROBE:
1
Die Nacht über war es stürmisch geblieben. Schon am Vortag hatte der Wind deutlich aufgefrischt und sich bis zum Abend zu einem kapitalen Sturm aus Südwest aufgebaut. Orkanböen peitschten über das Meer, über die Inseln, die Deiche, die Köge und das Marschland. Sie schleuderten den Regen mit wütender Kraft fast waagerecht gegen alles in ihrem Weg, ließen ihn mit dem knatternden Geräusch kleiner Silvesterknaller gegen Fensterscheiben prasseln und durchnässten in Sekundenschnelle jeden, der sich ohne die richtige Kleidung hinausgewagt hatte. Die wenigen Unerfahrenen, die einen Regenschirm aufspannten, merkten umgehend, warum kein einziger Einheimischer einen Schirm dabei hatte. Der vermeintliche Regenschutz taugte kaum gegen waagerecht heransausende Tropfen. Außerdem fand der Sturm in nur wenigen Augenblicken seinen Weg unter den Stoff, klappte ihn nach außen, verbog das Gestell. Die Papierkörbe in den Urlaubszentren entlang der Küste füllten sich mit Regenschirm-Kadavern.
Auf den Halligen hatte man längst das Vieh auf den Warften zusammengetrieben, die Fensterläden geschlossen. Die Menschen dort hatten getan, was zu tun war. Nun warteten sie in ihren Häusern bei Tee und Grog auf das Abflauen des Sturms und das Abebben der tosenden See. Ohne große Sorge, aber doch mit einer gewissen Unruhe. Sturmfluten war man hier, auf den Außenlanden, seit jeher gewöhnt. Die, die sich jetzt aufbaute, würde nicht zu den schweren gehören. Zwei Meter über dem Mittleren Hochwasser waren für fünf Uhr morgens vorausgesagt. Das war nichts, worüber man sich hier, an der Küste, aufregt hätte. Es beeinträchtigte den Fährverkehr und ganz allgemein die Bewegungsfreiheit. Es hielt die Feriengäste vom Strandspaziergang ab. Aber sonderlich bedrohlich war es nicht.
Carsten Mewes liebte es, wach im Bett zu liegen, wenn der Sturm um sein kleines Häuschen herum heulte. Sein Herz ging auf, wenn eine Bö den Regen gegen das Schlafzimmerfenster peitschte oder ein Hagelschauer auf die Dachziegel direkt über seinem geräumigen Ehebett prasselte. Die mächtigen alten Bäume vor seinem Haus stimmten mit nur leichtem Rauschen in den Gesang des Unwetters ein. Sie hatten jetzt, Ende April, noch kein Laub angesetzt, boten den Orkanböen nur wenig Widerstand.
Was Carsten Mewes hingegen nicht liebte, gerade in solchen Nächten, das war die Frühschicht. Bereits um 3:30 Uhr würde der Wecker klingeln. Eine halbe Stunde später musste er aus dem Haus, um rechtzeitig auf dem Bahnhof von Niebüll zu sein. Pünktlich um 4:31 Uhr würde er die erste Lok in Richtung Westerland in Bewegung setzen.
Schon als Kind hatte Mewes, wie angeblich so viele Jungen, davon geträumt, einmal Lokführer zu werden. Er gehörte zu den wenigen, die diesen Traum hatten wahr werden lassen. Allerdings war es für ihn schon längst kein verwirklichter Traum mehr, sondern zum zermürbenden Alltag im Schichtdienst geworden. Je älter er wurde, desto mehr verblasste der einstige Traum gegenüber der Realität eines um 3:30 Uhr klingelnden Weckers. Besonders hart waren die Tage des Wechsels von der Spät- zur Frühschicht. So wie heute. Als das leise Fiepen des Weckers einsetzte, war er wach. Immer noch wach, wie er meinte. Er hatte das Gefühl, in dieser Nacht nicht eine Minute Schlaf gefunden zu haben. Doch der um das Haus tosende Sturm hatte sie wenigstens zu einer wunderschönen schlaflosen Nacht gemacht.
Im Zimmer war es stockdunkel. Dennoch fand Carsten Mewes´ Hand die Austaste seines Weckers sofort und drückte sie, bevor das Fiepen anschwellen und Claudia wecken würde. Seine Frau schlief tief. Das hörte er an ihrem ruhigen, gleichmäßigen Atem. Sie hatte sich längst an seinen Schichtdienst gewöhnt und wachte nur noch selten auf, wenn er am frühen Morgen aus dem Bett musste oder erst spät am Abend hineinkroch. Auch sonst erweckte er schon seit Langem kaum noch etwas in ihr, schlich es sich ihm als bedauernder Gedanke in den Kopf. Sie lebten mehr nebeneinander als miteinander. „Zwei Züge im Leben, die dieselbe Strecke fuhren, die aufeinander getaktet waren, sich dabei aber niemals trafen“, dachte er, während er die Bettdecke zur Seite und seine Füße in die Filzpantoffeln schob. Trotz der bleiernen Müdigkeit musste er über diesen, ihm ungewohnt philosophisch anmutenden Gedanken grinsen, während er in die Küche schlurfte und die Kaffeemaschine anstellte. Der Kaffee würde durchlaufen, während er im Bad war. So früh am Morgen war jede eingesparte Minute ein kostbares Gut.
Ein Ast des großen Apfelbaums schlug zeitgleich mit einer kräftigen Regenbö unvermittelt gegen das Badezimmerfenster. Carsten Mewes schreckte zusammen, fuhr dann aber achselzuckend mit dem Zähneputzen fort. Es stürmte immer noch kräftig, mittlerweile aus Nordwest. Das hob seine Stimmung. In gut einer Stunde würde die Flut ihren Höchststand erreichen. Sturm und Flut – das versprach Wellen bis hoch hinauf auf die Flanken des Hindenburgdamms und hochgespritzte Gischt auf den Scheiben der Lok. Bei diesen Verhältnissen würde es ihm erscheinen, als führe er die acht Kilometer Seestrecke nach Sylt hinüber direkt durch ein aufgewühltes Meer. Ein bisschen Abenteuer, ein klein wenig Unabwägbarkeit in einem sonst eher eintönigen, von Fahrplänen und Schichtwechseln unbarmherzig strukturierten Alltag. Schade, dass die Sonne auf der Hinfahrt noch nicht aufgegangen sein würde. Doch auch so würde es ein Erlebnis sein, insbesondere, wenn ihm kurz vor der Insel die Bahn aus Westerland entgegenkommen würde und beide mit ihren Scheinwerfern die Strecke und die See beleuchteten. Auch die Rückfahrt, dann schon im ersten Tageslicht, versprach trotz ablaufenden Wassers noch aufregende Blicke auf eine tosende See.
Der Kaffee war bereits durchgelaufen, als Carsten Mewes in die Küche zurückkehrte. Gewaschen und frisch rasiert, fühlte er sich jetzt schon viel wacher. Er füllte zwei gehäufte Teelöffel Zucker in seinen großen Morgenbecher, goss den heißen Kaffee darauf, rührte um und kippte dann so viel Milch nach, dass das Getränk immer noch heiß, aber doch zügig zu trinken war. Das reichte ihm als Frühstück. Mehr bekam er um diese Uhrzeit ohnehin noch nicht hinunter. Nach seiner ersten Rückkehr des Tages, kurz nach sechs, würde er sich am Bahnhof in Niebüll ein ofenwarmes belegtes Brötchen holen, bevor es dann wieder hinüber nach Sylt gehen würde.
Der Kaffee stärkte seine Lebensgeister ganz unmittelbar. Er fühlte sich ausgeruht und hellwach, als er das Haus verließ.
Fast hätte es ihm die Mütze vom Kopf geweht, als er aus dem Windfang seines kleinen Häuschens hinaus ins Freie trat. Erst im letzten Moment konnte er sie mit einem schnellen, unbewusst ausgeführten Griff retten. Es zog im Nacken; beinahe hätte er sich bei der schnellen, ungewohnten Bewegung einen Halswirbel blockiert. Aber nur beinahe; es war noch mal gutgegangen.
Der Wind war kühl und erfrischend, nicht wirklich kalt. Mewes bildete sich ein, Seeluft darin zu riechen und Salz zu schmecken, obwohl das kleine Häuschen doch ein gutes Stück vom Meer entfernt stand. Sie hatten das Haus vor sieben Jahren von den Schwiegereltern geerbt. Sie waren nach einer Hochzeitsfeier in Büttjebüll betrunken mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und kopfüber im Kanal gelandet. Noch heute schauderte es Carsten Mewes, wenn er sich die grausamen letzten Minuten der beiden vorstellte – mit Kopf, Hals und Nacken vom eigenen Gewicht aufs Autodach gedrückt, unfähig, sich umzudrehen oder die Fenster oder Türen zu öffnen, durch die langsam aber stetig das Wasser eindrang und sie dann irgendwann im Laufe dieser Nacht ertränkte. Aber vielleicht, so hoffte er, hatten sie beim Aufprall auch das Bewusstsein verloren und von diesen letzten Minuten nichts oder nur wenig mitbekommen. Man hatte es nie gesichert herausfinden können. Der nur mit der Unterseite der Reifen aus dem Wasser ragende Wagen war erst am nächsten Morgen von einem Landwirt entdeckt worden. Da war es für Hilfe längst zu spät gewesen.
Der Zufall wollte es, dass die Kinder damals gerade mit der Schule fertig waren und er einen festen Arbeitsvertrag für die Bahnstrecken hier oben im Norden bekommen konnte. So tauschte Carsten Mewes die unregelmäßigen Einsatzorte überall in der Republik, die einst wichtiger Bestandteil seines Jugendtraums vom Lokführer-Beruf gewesen waren, gegen den regelmäßigen Arbeitsalltag im Norden Schleswig-Holsteins ein. Mit annähernd fünfzig Jahren erschien ihm das damals als angemessene Zukunftsplanung.
Carsten Mewes schloss die Tür sorgfältig hinter sich ab. Die Zeiten, in denen man die Türen ungesichert ließ, waren auch hier in Fahretoft längst vorbei. Früher, da waren er und seine Frau einfach ins Haus spaziert, wenn sie die Schwiegereltern oder deren Nachbarn besuchten. Doch irgendwann hatten die Eltern und nach und nach alle Anderen angefangen abzuschließen. Wann war das gewesen, und hatte es einen konkreten Auslöser gegeben? Er dachte darüber nach, konnte sich aber beim besten Willen nicht mehr erinnern. Einbrecher waren hier jedenfalls weder vorher noch nachher jemals am Werk gewesen. Nicht bei ihnen und auch bei keinem in der Nachbarschaft.
Der Wagen stand im Carport, mit dem Kühler zur Straße gedreht. Er stieg ein, startete ihn und stellte sofort die Sitzheizung an. Ein Luxus, den er sich beim letzten Autokauf gegönnt hatte und der ihm seither in der kalten Jahreszeit den Weg zur Frühschicht nicht nur erträglicher machte, sondern so sehr versüßte, dass er sich manchmal sogar einen längeren Anfahrtsweg zur Arbeit gewünscht hätte.
Doch mehr als zehn Minuten brauchte er jetzt, so früh am Morgen, nicht. Auf den kaum mehr als zehn Kilometern begegnete er nur drei anderen Fahrzeugen, die alle, genau wie er, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Zweimal musste er Ästen ausweichen, die der Sturm auf die Straße geschleudert hatte. Dreimal brach der Wagen in tiefen Pfützen fast aus. Eigentlich hätte er angesichts möglicher weiterer Sturmfolgen langsamer und vorsichtiger fahren müssen. Aber dieser Gedanke drang nur halb in sein Bewusstsein durch. Die Gewohnheit ließ ihn das Gaspedal durchtreten wie an jedem anderen Morgen. Und wie an jedem anderen Morgen hatte er auch dieses Mal Glück und kam unbeschadet an seinem Arbeitsplatz an. Zwei der Kollegen waren schon da.
„Moin Klaus, moin Thomas“, grüßte er im Vorbeigehen. „Alles klar?“
„Moin Carsten“, kam es zurück. „Alles bestens. Bei dir auch?“
Mehr hatten sie sich um diese Uhrzeit noch nicht zu sagen, und keiner blieb stehen, um eine Antwort auf diese achtlos dahingeworfenen Fragen abzuwarten. Später am Tag würden sie ein paar mehr Worte miteinander wechseln. Übers Wetter, die Fußballergebnisse, vielleicht auch über Urlaubspläne oder die Kinder. Aber eigentlich waren sie hier eher eine Zweckgemeinschaft von Menschen, die sich nur sehr oberflächlich füreinander interessierten und mit denen er vom Führerstand des Triebwagens oder der Lok aus vergleichsweise wenig Berührung hatte. Sie konnten sich aufeinander verlassen. Das wussten sie. Mehr war auch nicht nötig, fand er und war schon wieder völlig bei sich selbst, als er die Tür zum Führerstand aufschloss, sich auf seinen Sitz fallen ließ und die Maschine startete.
Die Absprache mit Fahrdienstleiter Reinhard Börnsen war nicht viel ausführlicher als das Gutenmorgen mit den Kollegen im Rangierbereich. Zehn Minuten vor ihm würde eine Bahn von Ecofare die gleiche Strecke nach Westerland rüber fahren, hatte Reinhard ihn informiert.
„Jetzt schon?“, hatte Carsten überrascht gefragt. Ecofare war der neue Mitbewerber auf der Strecke nach Sylt. Der sollte aber eigentlich erst ab Mai starten.
„Ist ne Überführungsfahrt“, kam die knappe Antwort. „Wird dir auch nicht im Wege sein. Sie halten nicht an den Bahnhöfen und sind eh viel schneller.“
„Schneller“ war ein Wort, das den Finger direkt in eine Wunde legte. Carsten Mewes hasste die Fahrt im Triebwagen. Viel zu kraftlos, viel zu langsam. Damit brauchte man ewig, um auf Fahrt zu kommen. Dafür war er nicht Lokführer geworden! Zudem war jeder, der dieses Teil fahren musste, dem Gespött der Anderen ausgesetzt. „Wanderdüne“ nannten sie diesen kraftlosen Haufen Blech. Aber wartet nur, im Laufe des Tages würde auch er noch eine richtige Lok unter den Hintern bekommen und dann zum Kollegen im Triebwagen rübergrinsen. Das entschädigte!
Gerne hätte Carsten Mewes auch mal eine der Loks von Ecofare ausprobiert. Sie sollten ordentlich Kraft auf die Schiene bringen, hieß es. Und sie fuhren durchweg mit Wasserstoffantrieb. Das fand er spannend. Komplett emissionsfrei! Überhaupt war Ecofare hier auf dem Bahnhof schon seit Wochen und Monaten lebhaftes Gesprächsthema unter den Kollegen. Das Unternehmen war angetreten, den Nahverkehr in Deutschland, ja in ganz Europa zu revolutionieren und komplett ökologisch zu gestalten. Vor drei Jahren hatte man das erste Mal von ihnen gehört. Inzwischen hatten sie eine eigene Fährlinie für Personen und Fracht zu den Inseln aufgebaut und ein gutes Dutzend Bahnstrecken in den Ausschreibungen für sich gewonnen. Am 1. Mai würden drei weitere hinzukommen, darunter die ganze Westküste bis nach Sylt. Autos und Lastwagen nahm Ecofare auf seinen Fähren grundsätzlich nur mit, wenn diese ebenfalls emissionsfrei fuhren. Das polarisierte und brachte allein für sich gesehen schon unglaublich viel Aufmerksamkeit. Die Tochter-GmbH einer Aktiengesellschaft mit Europasitz in Luxemburg war damit zu einem Lieblingsthema der Presse geworden. Sorgen um seinen Arbeitsplatz machte Carsten Mewes sich trotzdem nicht. Selbst wenn Ecofare seinen jetzigen Arbeitgeber aus dem Rennen drücken würde: Einen guten Lokführer würden auch die „Öko-Reisen“, wie er sich den Firmennamen mit Wörterbuch und ein wenig Intuition übersetzt hatte, brauchen.
Pünktlich um 4:27 Uhr stellte er seinen Zug auf Gleis 3 bereit. Einige wenige Pendler warteten bereits ungeduldig auf dem zugigen Bahnsteig darauf, endlich einsteigen zu können. In den Waggons war es bei der ersten Fahrt des Tages zwar kaum wärmer als draußen. Aber es war windgeschützt, und gerade setzte auch der Regen wieder ein und wurde von den Böen waagerecht unter die Überdachung getragen. Er kannte die Gesichter von allen, die hier warteten – und auch bei denen, die mit eiligen Schritten noch dazukamen, fiel ihm niemand Neues auf. Nicht, dass er auch nur einen Einzigen oder eine Einzige von den Fahrgästen mit Namen gekannt oder auch nur jemals ein Wort mit jemandem von ihnen gewechselt hätte. Aber Vertrautheit kann ja auch ohne Worte entstehen.
Sie alle, so nahm er an, quälten sich, wie er, an jedem Morgen aus dem Bett, weil das zum Job gehörte und es halt so sein musste. Ganz früh, weil sie ihre Arbeit auf der Insel gefunden hatten. Dort gab es aber keine Wohnungen, die sie sich hätten leisten können. Es waren Bäcker, Polizisten, Reinigungs-, Küchen- und Pflegekräfte – so stellte er es sich vor. Jobs, mit denen man auf Sylt sehr willkommen war, von denen man dort aber nicht leben konnte.
„Ich werde sie sicher auf die andere Seite der tosenden See bringen“, schoss es ihm in den Kopf. Und dann, mit breitem Grinsen, „das scheint mein philosophisch-pathetischer Morgen zu sein“.
4:31 Uhr. Auf die Sekunde genau kam das Zeichen zur Abfahrt. Er schob den Gashebel nach vorne. Der Zug setzte sich ruckelnd in Bewegung in Richtung Sylt.
Zehn Minuten brauchte er für die Fahrt durch die Marsch zum ersten Zwischenstopp. Fahrplangerecht um 4:41 Uhr rollte der Zug auf dem Bahnhof Klanxbüll ein. Hier warteten lediglich drei Personen auf dem Bahnsteig. Bis zur Abfahrt eine Minute später kam auch niemand mehr hinzu. Aber erstmals an diesem Morgen nahm er eine Person wahr, die er, soweit er wusste, noch nie gesehen hatte. Der hochgewachsene, schlanke Mann in seiner teuer wirkenden, dunklen Regenkleidung wäre ihm mit seiner beeindruckend geraden, entspannten Haltung sicherlich aufgefallen. Das Gesicht war von einer Kapuze verhüllt. Auch nach dem Einsteigen konnte er es nicht erkennen, denn der Unbekannte setzte sich zwar mit Blick in seine Richtung, wurde aber durch eine Trennleiste im Waggon weitgehend verdeckt.
4:42 Uhr. Wieder setzte sich die Bahn langsam und ruckelnd in Bewegung. Ein kurzes Stück hinter Klanxbüll bog sie von ihrem Nordwestkurs in einer Linkskurve direkt nach Westen auf den Hindenburgdamm ab. Der 1927 erbaute und später auf zwei Gleise erweiterte Eisenbahndamm führte direkt hinüber auf die Insel, gute acht Kilometer durch das Wattenmeer. Dieses Meer, das meistens ruhig und bei Ebbe oftmals gar nicht als Meer zu erkennen war, würde jetzt wild toben. Bei Carsten Mewes stieg die Vorfreude auf diesen Anblick, während er das letzte Stück der Kurve hinter sich ließ, den schützenden Festlandsdeich kreuzte und auf den Damm hinaussteuerte. Der Triebwagen war nun genau nach Westen ausgerichtet, bot den Orkanböen damit die halbe Breitseite und wurde kräftig durchgeschüttelt, während er sich langsam zwischen die auf beiden Seiten der Bahnlinie hoch aufgetürmten, gischtenden Wellen schob.
Carsten Mewes dachte bei diesem Anblick an seine Kindheit zurück, an seinen Traum, Lokführer zu werden, dessen Ursprung er in diesem Moment wieder so warm und nah fühlte wie damals. „Jim Knopf und die Wilde Dreizehn“, aufgeführt von der Augsburger Puppenkiste. Aufgeregte Sonntagnachmittage vor dem Fernsehgerät. Lukas, der Lokomotivführer von Lummerland, der mit dem Waisenkind Jim Knopf die Insel verlassen muss und mit seiner tapferen Dampflok Emma scheinbar unbeeindruckt von physikalischen Gesetzen die Wellen des Meeres durchpflügt, um Abenteuer in fernen Ländern zu bestehen. Ein verträumtes Lächeln verklärte sein Gesicht.
Doch schon einen Augenblick später fand die Freude ein jähes Ende. Direkt vor ihm war das Rotsignal gesetzt. Kreischend und quietschend kam die Bahn mitten im tosenden Meer zum Stehen, ohne dass der Lokführer auch nur eine Hand dafür hätte rühren müssen. Und auch ohne dass er etwas dagegen hätte tun können. Das Rotsignal hatte eine Zwangsbremsung ausgelöst. Völlig unerwartet für den Lokführer. Rot hatte er um diese Uhrzeit und an dieser Stelle noch nie gesehen.
„Was ist denn das jetzt für ein Mist“, fluchte er und wusste die Antwort darauf eigentlich schon, bevor er vom Fahrdienstleiter die Erklärung erhielt. Der nagelneue Ecofare-Zug hatte auf dem Damm gestoppt. Beziehungsweise war gestoppt worden, wie es hieß. Jemand hatte in Höhe der Blockstelle eine Notbremsung ausgelöst. Aber es hätte gar kein „Jemand“ im Zug sein dürfen. Der Zugführer war ausgestiegen, nachdem er Meldung gemacht hatte. Jetzt wartete der Fahrdienstleiter auf weitere Informationen. So lange würde Carsten Mewes hier an Ort und Stelle ausharren müssen, und mit ihm seine Passagiere, die natürlich alle keine Zeit zu verlieren hatten auf ihrem Weg zur Arbeit. Wären sie sonst hier so früh an Bord? Er stellte das Mikrofon an und entschied sich für eine laxe, norddeutsche Ansprache mit einem kleinen Seitenhieb auf den Mitbewerber.
„Moin Leute, tut mir leid. Einer von den grünen Ecofare Frischlingen hat ´ne Panne und blockiert uns. Ich hoffe, die Wasserstoffschaukel kommt schnell wieder in die Gänge.“
Mewes schaltete das Mikrofon wieder aus und blickte durch die Scheibe nach hinten in den Waggon. Er sah genervte, frustrierte aber auch gelangweilt-schläfrige Gesichter, einen Stinkefinger und demonstrative Blicke auf echte und imaginäre Armbanduhren. Er drehte sich wieder um. Im Moment gab es nichts weiter zu tun als abzuwarten – und den Ausblick zu genießen. Im leider recht begrenzten Scheinwerferkegel sah er die weißen Kronen der Wellen tanzen. Manche Brecher ließen ihre Wucht sogar über die Schienen branden. Dichte Vorhänge aus Regentropfen fegten in engen Abständen über den Damm und nahmen ihm fast vollständig die Sicht, wenn sie auf die Front- und Seitenscheiben prallten. Die Scheibenwischer waren weitgehend machtlos gegen diese Schwemme. Die ganze Bahn zitterte im Rhythmus der Böen, die von schräg vorne gegen ihre Seiten pressten.
Dann sprang das Signal unvermittelt auf grün. Carsten Mewes schob den Gashebel nach vorn.
„Was war denn los“, wollte er vom Fahrdienstleiter wissen.
„Irgendwas mit Notbremse und offener Waggontür, aber kein Mensch zu finden“, kam die Antwort. „Schwer zu verstehen: Der Kollege spricht drei oder mehr Sprachen durcheinander. Mach langsam, Carsten, und halt die Augen auf dem Damm offen. Besonders im Bereich um die Blockstelle.“
Mit einem „Moin nochmal, Leute“ wendete der Lokführer sich erneut an seine Fahrgäste. „Wie ihr merkt, geht`s nun weiter. Fünf Minuten Verspätung. Sorry, nochmal, bleibt uns treu. Schuld waren die Neuen.“
„Ich werd´ Gas geben“, versprach er dann noch. Hatte aber nicht im Entferntesten vor, dies wirklich zu tun. Er hatte jetzt nämlich ein richtig mulmiges Gefühl im Bauch. Der Regen prasselte auf die Scheibe, die Sicht war miserabel und irgendetwas war merkwürdig da draußen. Er legte die linke Hand auf den Schalter für die Schnellbremsung, während die rechte den Gashebel nur behutsam nach vorne schob. Eine heftige Bö setzte die Frontscheibe unter Wasser. Für einen Augenblick sah Carsten Mewes nichts außer Wasser, durch das sich die Scheibenwischer mühsam einen Weg bahnten.
Als der Blick wieder freier wurde, war es zu spät. Die Linke betätigte wie von selbst die Bremse, die Rechte zog den Gashebel zurück. Die Körper der schlaftrunkenen Passagiere setzten, den Fliehkräften unterworfen, ihre Reise mit unverminderter Geschwindigkeit fort, während das Fahrzeug unter ihnen abrupt langsamer wurde. Sie wurden nach vorne geschleudert, von den Sitzen hinunter, auf den Boden, die Bänke oder die Rückenlehnen vor ihnen. Nur die wenigen, die sich gegen die Fahrtrichtung gesetzt hatten, drückte es lediglich gegen die eigene Rückbank. Einige schrien auf, viele fluchten oder brüllten ein empörtes „Ey!“. Einzig der große, schlanke Mann in dunkler Regenkleidung saß völlig ungerührt da. Mit seinem locker über die Rückenlehne gelegten Arm und einem Fuß auf der Sitzkante gegenüber hatte er die Fliehkräfte mühelos aufgefangen. Fast schien es, als wäre er vorbereitet gewesen auf das, was kam.
Carsten Mewes starrte entsetzt auf die Gleise vor ihm, während der Zug trotz der geringen Geschwindigkeit viel zu langsam an Fahrt verlor. Es würde nicht reichen, das wusste er. Sein Körper war wie gelähmt. Sämtliche Adern hatten sich schlagartig erweitert und das Blut in die Beine und Füße abgleiten lassen. Der Kopf blieb blutleer und kreidebleich zurück, aber die Wahrnehmung hatte dennoch nicht ausgesetzt. Er sah wie in Zeitlupe, wie die unter der Bremsung kreischende Bahn sich Meter für Meter auf den Körper zuschob, der in Längsrichtung, den Kopf in Richtung Zug, auf der rechten der beiden glänzenden Stahlschienen lag, die zusammen das Gleis bildeten. Er nahm unbeschreiblich detailliert wahr – und würde dieses Bild für immer in sich tragen -, wie der Mann da draußen bäuchlings und vollkommen reglos auf der Schiene lag. Die beiden Hände waren wie zum Schutz auf den Hinterkopf gelegt, je ein Bein links und rechts der Schiene platziert, der Körper mittig auf ihr ausgerichtet.
Mit Verwunderung nahm Carsten Mewes wahr, dass der Mann dort auf den Schienen unpassend gekleidet war, und gleichzeitig wunderte sich der Lokführer über seine eigene, in dieser Situation irgendwie unpassende Beurteilung der Kleidung. Trotzdem formulierte sich beim Anblick des nur mit einem vom Regen aufgeweichten Hemd und einer ebenso nassen Hose bekleideten Körpers ein „Der muss doch wahnsinnig frieren“ in seinem Kopf. Der Körper verschwand aus seinem Blickfeld und es gab einen dumpfen Schlag gegen das Bodenblech. Dann endlich stand der Zug. Dass es zu spät sein würde, hatte er schon gewusst, als seine linke Hand noch vor der Anweisung des Gehirns die Bremsung eingeleitet hatte.
Eine Sekunde lang – vielleicht waren es auch zwei, drei oder sogar fünf Sekunden – klebte Carsten Mewes noch in unveränderter Haltung auf seinem Sitz fest. Dann löste sich die Schockstarre. Er sprang hoch, riss die Tür des Führerstands auf und rannte nach hinten. Die empörten, fragenden, klagenden und verwirrten Rufe der Passagiere drangen nicht zu ihm durch. Die nächstgelegene rechte Tür stand offen. Erst viel später würde er sich darüber wundern. Jetzt sprang er lediglich ohne abzubremsen hinaus auf den meerumtosten Damm und wurde unmittelbar von einem Schwall hochschäumender Gischt durchnässt, der wie ein eisiger Schlag auf Körper und Gesicht traf. Sein Atem stockte, aber dann war er plötzlich wieder ganz bei sich. Die eisige Dusche hatte eine bemerkenswerte Wirkung auf ihn, zog ihn ins bewusste Sein zurück. Der Geist wurde klar, die Ruhe kam zurück.
„Personenunfall! Alle bleiben auf Ihren Plätzen!“, brüllte er ins Wageninnere und verfluchte innerlich, dass diese erste Tour des Tages ohne Kundenbetreuer gefahren wurde. Dann wandte er sich der Schiene zu. Im Licht eines Zuges, der in diesem Moment von Sylt kommend auf sie zufuhr und angesichts der unklaren Situation sein Tempo verlangsamte, sah er den Körper. Aber nicht unter dem Zug. Beim Aufprall nach rechts geschleudert, lag der Oberkörper auf dem Damm, die Beine ragten hinunter und wurden im Sekundentakt von den auf den Damm emporleckenden Wellen bewegt. Es mutete an, als versuche der Mann, sich mit den Beinen nach oben zu schieben. Carsten Mewes lief zu ihm, aber der Zustand von Kopf und Oberkörper machte überdeutlich, dass in diesem Körper kein Leben mehr sein konnte.
Dem Lokführer wurde speiübel. Er wankte zurück zur offenen Waggontür. Die Wellen, die ihn dabei ein ums andere Mal trafen, und den prasselnden Regen nahm er kaum wahr. Er rettete sich in den Wagen, zog mühsam die Türen zu, ignorierte die Gesichter, die sich ihm fragend zuwandten. Taumelnd hastete er in den Führerstand zurück und meldete dem Fahrdienstleiter stammelnd, was passiert war. Während dieser alles Notwendige einleitete, sank Carsten Mewes erschöpft in seinen Sitz und starrte, vor Aufregung und Kälte am ganzen Körper zitternd, nach hinten in den Waggon. Er fühlte sich ausgebrannt und gleichzeitig tief betroffen. Trotzdem funktionierte seine Wahrnehmung noch recht gut und ließ ihn stutzen. Der dunkel gekleidete Fremde war nicht mehr zu sehen.
2
Der innere Schweinehund hatte auch an diesem Morgen mal wieder keine Chance. Hark Petersen wachte wie immer eine Minute vor dem Weckerklingeln auf und schob diesen Schweinehund und dessen Einflüsterung, sich noch mal gemütlich umzudrehen, entschlossen zur Seite. Redlef hatte am späten Abend angerufen. Er wollte schon zwei Stunden früher hier sein als ursprünglich verabredet. Hark sollte sich noch eine Ermittlungsakte anschauen, die seinen Freund irritierte. Es ging um den vermeintlichen Selbstmord eines Journalisten letzte Woche auf dem Hindenburgdamm. „Eine ganz und gar abstruse Sache“, wie Oberstaatsanwalt Redlef Maier meinte.
So sprang Kriminalhauptkommissar Hark Petersen trotz seines Kurzurlaubs bereits in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett, putzte die Zähne, wusch das Gesicht, zog den Jogginganzug über und war bereits fünf Minuten später unrasiert und ungekämmt im breiten Treppenhaus auf dem Weg nach unten.
In straffem Tempo durchquerte er das Husumer Hafengebiet. Es war Ebbe, und die Schiffe an der Kaimauer lagen, trockengefallen, auf dem Hafenschlick auf. Wenig später war er bereits auf dem Außendeich unterwegs, froh darüber, dem Impuls, sich noch einmal im Bett umzudrehen, widerstanden zu haben. Eine seiner Strategien gegen den inneren Schweinehund war der Schrittzähler in seinem Smartphone, der nicht nur jeden einzelnen gelaufenen Meter amtlich machte, sondern auch noch die Geschwindigkeit und den angeblichen Kalorienverbrauch dokumentierte. Ein irgendwie alberner, fast kindischer Ansporn, wie er fand, aber trotz dieser Einsicht war der Ansporn wirksam.
Die Luft war klar. Der Wind blies frisch über das Meer heran und riss immer breitere Lücken in die Wolkendecke. Nach den Stürmen, der Kühle und den Regenschauern der letzten Tage würde heute und für den Rest der Woche ein stabiles Hochdruckgebiet das Wetter an der Küste bestimmen. So war es jedenfalls vorausgesagt. Dieses Hoch würde warme Luft aus dem Süden bis weit hinauf in den Norden pumpen. Die ersten Maitage versprachen sommerlich warm zu werden.
Hark Petersen selbst fand eigentlich fast jede Wetterlage akzeptabel. Solange es nicht fortwährend regnete oder windstille Hitze über dem Land brütete, genoss er Kälte und Sturm ebenso sehr wie milde Luft und wärmende Sonnenstrahlen. Aber die aktuelle Wettervorhersage freute ihn trotzdem ungemein. Nicht für sich selbst, sondern für Leif!
Leif Hansen war bis vor kurzem sein Assistent bei der Mordkommission hier in Husum gewesen. Dann hatte er sich bei Ermittlungen auf Amrum in eine Insulanerin verliebt und sich im November letzten Jahres mit einflussnehmender Hilfe von Hark und Redlef zur Amrumer Polizeidienststelle in Nebel versetzen lassen. In zwei Tagen würden die beiden heiraten. Bei schönstem Frühlingswetter, wie es aussah, und im Kreise all ihrer Freunde und Kollegen, die sie für mehrere Tage auf die Insel eingeladen hatten. Auch Hark und Redlef würden natürlich dabei sein. Sie wollten sich gegen Mittag mit Harks Frau Freddy und Redlefs neuer Freundin Beatrice an der Fähre treffen. Die beiden Frauen reisten gemeinsam aus Kiel an, während Redlef gestern noch zu Besprechungen in Hamburg und Bad Bramstedt gewesen war und Hark auf dem Weg nach Dagebüll in Husum abholen würde.
Es war noch nicht viel los auf Husums Straßen, als Hark die Deichwiesen hinter sich ließ und ins Häuserlabyrinth der Stadt eintauchte. Wenig später erreichte er den Schlosspark. Das war ein durchaus gefährlicher Ort um diese Uhrzeit, denn die Krähen saßen noch auf ihren Schlafbäumen und bereiteten sich auf die Morgentoilette vor. Sollte sich auch nur eine von ihnen vor dem Läufer da unten erschrecken und die anderen mit aufscheuchen, wäre er einem Bombardement von Kot ausgesetzt. Die enorme Krähendichte dieses Parks drohte mit hundertfachem Trefferrisiko. Nachdem ihm das einmal passiert war, lief er hier nur noch mit gemischten Gefühlen hindurch. Gleichwohl trotzte er der Gefahr; vor Drohungen zurückzuweichen lag ihm nicht.
Doch was hatten diese Landvögel überhaupt hier zu suchen, in Theodor Storms „Grauer Stadt am Meer“?, fragte sich Petersen. Nun ja, im Gegenzug hatten die Möwen mittlerweile das Binnenland erobert und nervten die Städter im Frühjahr mit ihrem Brunft- und Brutgeschrei. Die Flachdächer von Schulen, Gewerbeimmobilien und Privathäusern boten ihren Gelegen mehr Schutz als Dünenlandschaften, und Nahrung schien es nicht nur auf städtischen Mülldeponien im Überfluss zu geben. Verrückt verschobene Vogelwelt…
Noch sechs Minuten bis zurück zur Wohnung.
„Fünf, wenn du Gas gibst“, sagte sich Hark und drehte noch mal richtig auf. Schließlich wollte er nach seinem läuferischen Fiasko im Vorjahr beim Amrumer Insellauf in diesem Herbst wieder einen der vorderen Plätze belegen. Seine Füße flogen nun so schnell über das Kopfsteinpflaster hinweg, dass die vielen Unebenheiten fast nicht mehr auffielen. Nur gut, dass hier um diese Uhrzeit noch kaum jemand unterwegs war, auf den er Rücksicht hätte nehmen müssen.
Die Sonne schien bereits mit leuchtend heller Kraft über die überwiegend flachen Häuserreihen hinweg, als er den Hafen erreichte. Ohne groß abzubremsen stieß Hark die Haustür auf, nahm drei Stufen auf einmal ins Obergeschoss hinauf und stoppte erst im Badezimmer richtig ab. Die Wohnung abzuschließen, hatte er sich beim Loslaufen geschenkt. Diebe um diese Uhrzeit und so weit oben im Haus? Da hätten sie ja gleich einen normalen Job ausüben können! Außerdem wär’s doch mal was, einen Einbrecher in den eigenen vier Wänden zu erwischen. Amüsiert stellte er sich dessen langes Gesicht vor, wenn er „Polizei, Sie sind festgenommen!“ rief.
„Und stell dir erst mal deinlanges Gesicht vor, wenn er schon den Tresor geknackt und deine Dienstwaffe auf dich gerichtet hat“, hielt eine innere Stimme dagegen. Er ließ sie mit einem Schwall eisigen Wassers aus der Dusche verstummen. Aber die Kälte ertrug er dann doch nur kurz. Hark Petersen zog warmes Duschen bei weitem vor.
Vor dem Spiegel rubbelte er sein gerade mal wieder etwas zu langes, dunkelbraunes, von zunehmendem Grau aufgehelltes lockiges Haar trocken. Glatte Rasur oder Dreitagebart? Petersen entschied sich für die Stoppeln. Freddy, die er nun schon seit über einer Woche nicht mehr gesehen hatte, mochte das. Außerdem unterstrich es den Kontrast zu Redlef noch mehr. Dieser Kontrast machte den beiden Freunden inzwischen richtig Spaß. Der zu jeder Tageszeit glattrasierte Oberstaatsanwalt legte größten Wert auf sein repräsentatives, gepflegtes Äußeres. Egal, ob sie sich am Gericht trafen oder durch die Kneipen im Hamburger Schanzenviertel zogen: Die Male, die Hark seinen Freund ohne Anzug und Krawatte gesehen hatte, konnte er an zwei Fingern abzählen. Das war jeweils bei ihm zuhause gewesen. Hark selbst hingegen war mehr für die praktische, natürlich ebenfalls gepflegte „Dienstkleidung“ zu haben: Jeans, Sweatshirt, Turnschuhe und ein sportliches Sakko, das sein Pistolenholster und die Handschellen verdeckte, ohne den schnellen Griff zu ihnen zu blockieren.
Fürs Frühstück warf Hark die höllenteure Espressomaschine an, die Freddy ihm vor fünf Jahren zum Einzug in seine Wohnung am Husumer Hafen geschenkt hatte – zusammen mit einem leidenschaftlichen Kuss, der diesen Beginn eines neuen Lebensabschnitts besiegelte, in den sie nach 22 Ehejahren eintauchten, und der deutlich machen sollte, dass sie ein Paar bleiben würden.
Inzwischen war die Fernehe für sie beide zum Alltag geworden und, wohl auch aufgrund der geringen Distanz zwischen ihren Wohnorten und der Arbeit, die beider Alltag ausfüllte, längst nicht mehr so schmerzhaft wie in den ersten Monaten. Sieführte weiterhin ihre Arztpraxis in Kiel und wohnte dort im gemeinsamen Haus, in das ihre Kinder Max und Beckie nur noch in den Semesterferien gelegentlich zurückkehrten. Erkonzentrierte sich auf die Leitung der Mordkommission in Husum und eilte nach Kiel, wann immer es seine Zeit zuließ. Oder sie trafen sich hier in Husum – oder am liebsten bei Lizzy auf Amrum, wo sie jederzeit mehr als willkommen waren. Bei seiner Tante Lizzy hatte Hark seit frühester Kindheit immer wieder die Ferien verbracht. Nach der Heirat mit Freddy war sie auch für die junge Familie zu einem Ankerpunkt im Leben geworden.
Mit frisch gebrühtem Cappuccino und einer Scheibe Brot in der Hand genoss Hark vom Sofa aus den Blick auf den von der Morgensonne beschienenen Binnenhafen. Er liebte sein Apartment in einem der wenigen etwas höheren Wohngebäude am Hafen, das früher mal eine Fabrik gewesen war und durch riesige Kassettenfenster einen grandios weiten Blick über Hafen, Stadt und Landschaft erlaubte. Selbst das Meer konnte man von hier aus erahnen, wenn auch nicht wirklich sehen. Die Wohnung war klein genug für ihn als Einzelperson, bot aber doch genügend Raum, dass Frederike oder eines der Kinder ihn dort besuchen konnten. Leif Hansen hatte sie einst „Das Loft vom Chef“ getauft. Ein Begriff, der sich nach anfangs vehementer Ablehnung inzwischen auch bei ihm selbst gelegentlich einschlich.
3
„Ihr habt es gesehen! Ostern! Die Hölle ist über uns hereingebrochen! Wieder einmal! Die ganze Insel voll mit diesen Stinkern! Hin und her sind sie gerast! Für die kleinsten Wege die Karre angeschmissen! Laut! Rücksichtslos! Mörderisch! Tödlich! Also, mir reicht’s! Euch auch? Heute! Ja! Ab heute schlagen wir zurück!“
Zehn Minuten lang hatte Bodo von Thien auf diesen Höhepunkt seiner Rede hingearbeitet. Der Vorsitzende von „Amrum autofrei e.V.“ hatte gezielt und äußerst routiniert die Wut in sich aufsteigen und bis zum Kochen hochheizen lassen. Kopf und Ohren waren puterrot, die Hände zu Fäusten geballt, er atmete schwer und schabte mit dem Fuß wie ein Stier vor dem Angriff. Er hatte seine Mitglieder wachrütteln und auf den aktiven Widerstand einschwören wollen. Es war ihm gelungen! Sie klatschten leidenschaftlich, riefen „bravo“, „stimmt genau“, „recht hast du“ und gaben jetzt, da er geendet hatte, ihre eigenen wütenden Kommentare ab.
„Mir reicht´s schon längst!“, „Jetzt ist Feierabend!“, „Ich hab´ total die Schnauze voll von diesen Irren!“, „Einer hat fast meine Enkelin umgenietet!“, „Das muss endlich aufhören!“, „Wir müssen sie stoppen!“, „Wir zeigen`s ihnen!“
Der Anflug eines Lächelns umspielte die Lippen des hochgewachsenen, bulligen Maschinenbauingenieurs. Er war zufrieden mit der Wirkung seiner Worte. Sein Blick glitt von Einem zum Anderen in der leider viel zu kleinen Runde, die sich da in seiner geräumigen Doppelgarage in Süddorf versammelt hatte. Wen er auch anschaute: Sie alle waren jetzt genau so wütend, wie er es ihnen gerade vorgelebt hatte. Sie würden alle mitmachen, wenn es hieß, die Autoflut zu stoppen.
„Heute kommt die nächste große Welle!“, brüllte er, als die Rufe langsam abebbten. „Diesmal stellen wir uns ihr entgegen!“ … Und nach kurzem, dramaturgischem Zögern: „Wir schmeißen die Autos von der Insel, so wie ich sie aus dieser Garage geschmissen habe! Wer ist dabei?“
Alle Hände flogen ohne das kleinste Zögern nach oben. Ein Lynchmob, den man, mit Knüppeln in der Hand, auf ein beliebiges Ziel hätte loslassen können, stellte der Vorsitzende befriedigt fest. So hatte er es seinerzeit in der Firma gemacht, wenn es darum ging, das Team einzuschwören und zu Höchstleistungen im Kampf gegen die Mitbewerber anzufeuern. Seit sein Sohn den Betrieb übernommen und er sich auf die Insel zurückgezogen hatte, fehlte es ihm ein wenig an Gelegenheiten. Der Vereinsvorsitz und das höhere Ziel gaben ihm nun endlich wieder die Chance, sich mit seiner charismatischen Persönlichkeit voll einzubringen.
Lynchen würden sie heute allerdings niemanden, und Knüppel waren auch nicht vorgesehen. Aber trotzdem: Heute war der Tag X. Ab heute würden sie ihren Kampf gegen die Autos auf Amrum aktiv und unübersehbar führen. Mit den Feriengästen würden sie beginnen, aber das Endziel war bereits klar formuliert: Auf Amrum sollte in spätestens fünf Jahren kein einziger stinkender Motor und möglichst überhaupt kein Privatfahrzeug mehr laufen.
Noch waren sie erst wenige. Gerade mal ein Dutzend fest entschlossener Kämpfer. Aber wenn sie erst einmal in der Öffentlichkeit auftauchten mit ihren Aktionen, würde die Schar der Anhänger schnell anwachsen. Ihre Botschaft war schließlich sehr überzeugend, fand er. Und sie waren die gesellschaftliche Mitte, nicht irgendwelche grünen Phantasten. Sie hatten nichts gegen Autos an sich. Ihnen ging es einzig und allein um die Autos hier auf der Insel, die mit ihren Abgasen die Nordseeluft verpesteten, die Straßen für sich beanspruchten und mit ihrem Lärm die Ruhe störten. Wer sollte sich dem nicht anschließen wollen?
„Rolf, du nimmst dir mit Krischan und Ole die Autos drüben in Dagebüll vor. Fangt mit denen in den Amrum-Reihen an.“ Bodo von Thien liebte es, Befehle geben zu können. „Ihr anderen geht mit Johann Steffens Plakate kleben. Von Norddorf bis Wittdün. Jede freie Stelle! Treffen hier in zwei Stunden. Dann ziehen wir los und legen die Straße lahm. Wenn sie Chaos säen, werden sie Chaos ernten!“
Seine Leute stürmten los und ließen Bodo von Thien allein in seiner dauerhaft zweckentfremdeten Garage zurück. Der Vorsitzende beglückwünschte sich dazu, mit Johann Steffens einen Stellvertreter im Verein aufgebaut zu haben, der die Leute im Griff hatte. Der pensionierte Oberstudienrat war in seiner knurrig-sturen Art nicht leicht im Umgang, aber ein unfehlbarer Garant dafür, dass die an ihn vergebenen Aufgaben buchstabengetreu umgesetzt würden. Gleichzeitig war er viel zu kantig im Wesen, um ihm jemals den Vorsitz im Verein streitig machen zu können. Ambitionen dazu hätte er sicherlich, aber nicht die geringste Chance.
Während seine Mitstreiter die Garage verließen, griff Bodo von Thien zum Telefon. Jetzt galt es, ihre Aktion an die Öffentlichkeit zu bringen, und dafür hatte er sich einen mächtigen Verbündeten an Bord geholt: den Ecofare-Konzern mit seiner Pressestelle. Kein Traumpartner, zugegeben, denn denen ging es um den Verkehr in ganz Europa, um Ökologie und ähnlichen Kram, mit dem er und seine Leute überhaupt nichts am Hut hatten. Aber bezüglich Autos auf Amrum saßen sie im gleichen Boot. Das galt es zu nutzen. Vielleicht würden die sogar eine Inselbahn hier etablieren!
„Es geht los“, informierte er seine Gesprächspartnerin in militärischer Knappheit. „Wie geplant, die 15-Uhr-Fähre. Drei sind unterwegs nach Dagebüll. Von hierziehen wir in zwei Stunden los. Kommt die Presse?“ … „Fernsehen? Großartig!“
Lächelnd steckte Bodo von Thien sein Smartphone in die Tasche zurück. Dann ging er gut gelaunt pfeifend ins Haus und bereitete sich ein üppiges zweites Frühstück zu.
4
Hark legte die Mappe nachdenklich auf den niedrigen Couchtisch und lehnte sich im Sofa zurück. Sein Blick strebte weit hinaus zum Horizont, in den inzwischen strahlend blauen Himmel hinein, ohne etwas von dem, was er da sah, wahrzunehmen. In Gedanken ging er noch einmal alles durch, was er gerade gelesen hatte. Redlef Maier saß ihm schräg gegenüber in einem breiten, bequemen Sessel und hatte sich nicht mehr gerührt, seit er dem Kriminalkommissar die Kopie der Ermittlungsakte mit der Bitte überreicht hatte, sie zu lesen. Aber er hatte das Gesicht seines Freundes die ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen und versucht, dessen Gedanken und Gefühle schon während der Lektüre zu erraten. Petersen, der bei der Arbeit durchaus ein undurchdringliches Pokerface aufzusetzen wusste, hatte, den Wunsch seines Freundes erratend, viel von seinen Gedanken und Gefühlen nach außen dringen lassen. Vor allem war es Verwirrung und ein bis zur Fassungslosigkeit reichendes Staunen, was sich in seinen Gesichtszügen abzeichnete.
Endlich rührte er sich und schaute Redlef in die fragenden Augen. Der Oberstaatsanwalt nahm dies als Signal, sein Schweigen zu beenden, sagte aber nur ein einziges Wort: „Und?“
Hark zögerte einen Moment, atmete tief ein und fragte „Woher hast du das?“.
„Von der Bundespolizei, besser gesagt, von der Bundesbahnpolizei – oder, noch besser ausgedrückt, von jemandemdort“, antwortete Redlef. „Es ist der Bericht, der Abschluss-Bericht des Bundesbahninspektors, der den Todesfall letzte Woche auf dem Hindenburgdamm untersucht hat. Ein Bundesbahn-Oberrat hat ihn mir gestern bei einem gemeinsamen Abendessen zugesteckt. Vertraulich. Er wollte wissen, was ich davon halte. Und diese Frage gebe ich hiermit an dich weiter. Was sagst du dazu?“
Ein breites Grinsen zeigte sich auf Harks Gesicht, wich aber gleich wieder einer ernsten Miene.
„Okay, Redlef, ich fasse mal zusammen, was da herauszulesen ist: Peter Kurtz, ein Journalist, wird in seinem Redaktionsbüro in Hamburg überfallen. Man schlägt ihn zusammen, raubt ihn aus und verschwindet. Ein typischer Fall von Beschaffungskriminalität, wie hier steht. Daraufhin wird dieser Journalist sehr traurig, todtraurig, um es buchstäblich auszudrücken. Anstatt die Polizei zu rufen, fährt er, bei echtem Sauwetter nur mit Hemd und Hose bekleidet, barfuß und auf nicht ermitteltem Wege ins gut 200 Kilometer entfernte Niebüll, verschafft sich in der Nacht Zugang zu einem Zug der Ecofare Gesellschaft, der um 4:20 Uhr in Richtung Sylt abfährt. Während der Fahrt sendet er via Smartphone eine Abschieds-Mail gleichlautend an drei Redaktionen, für die er arbeitet, mit der kurzen Erklärung, man sei in sein Büro eingedrungen, habe ihn geschlagen und seine Recherche-Unterlagen gestohlen, und nun wolle er nicht mehr leben. Mitten auf dem Hindenburgdamm zieht er dann die Notbremse, öffnet die Notverriegelung, steigt aus, wirft sein Handy weg und versteckt sich auf dem meerumtosten Damm so lange vor dem Zugführer, bis dieser wieder abfährt. Dann legt er sich in Regen, Sturm und Gischt auf eine harte, eisig kalte Eisenbahnschiene und lässt sich vom 4:31 Uhr Zug nach Westerland überrollen. Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?“
„So habe ich das auch gelesen und der Oberrat ebenfalls“, antwortete der Staatsanwalt. „Was sagst du dazu?“
„Du weißt, dass mir Kollegenschelte nicht liegt, aber das ist mit Abstand der größte Schwachsinn, den ich jemals in einem Untersuchungsbericht gelesen habe“, seufzte der Kommissar. „Allerdings ist es so komplett irrsinnig, dass man nicht davon ausgehen kann, dass der Inspektor selber allen Ernstes an einen Selbstmord glaubt. Also stellt sich die Frage nach seiner Motivation. Und natürlich danach, was tatsächlich passiert ist: wer diesen Journalisten ermordet hat und warum.“
Wenn Ihnen dieser Einstieg gefällt und Sie den Küsten-Krimi als eBook für 4,99 Euro kaufen möchten, kommen Sie für Kindle hier auf die Amazon-Bestellseite.
Als Taschenbuch ist es im Buchhandel sowie bei Amazon verfügbar und kostet 11,90 Euro. Den den Taschenbuch-Kauf bei Amazon klicken Sie hier.