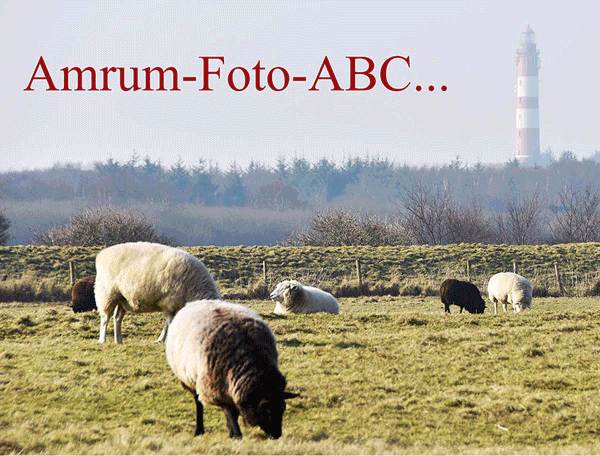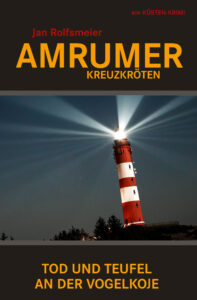 Tod und Teufel an der Vogelkoje – Hark Petersens 5. Fall
Tod und Teufel an der Vogelkoje – Hark Petersens 5. Fall
Kommissar Hark Petersen ermittelt in der wunderschönen Küstenlandschaft Nordfrieslands. Schnell wird dabei klar: Wenn es um Kröten geht, verstehen die Amrumer keinen Spaß. Egal, ob mit dem Wort die Tierwelt gemeint ist oder Geld. Die Emotionen kochen hoch, und schon wieder muss Petersen in einem Mordfall ermitteln. Als seine Tante Lizzy in Verdacht gerät, wird ihm der Fall entzogen. Es beginnt ein nervenaufreibendes Katz- und Maus-Spiel zwischen Petersen, der an Lizzys Unschuld glaubt, und übel gelaunten Ermittlern, die im Großeinsatz nach der untergetauchten Insulanerin suchen.
– 1 –
Die Nacht war so kühl, wie man es jetzt, Ende März, erwarten musste. Aber immerhin trocken. Dr. Lauritz Frohnwein hatte es sich mit einer Decke auf dem Boden und einer weiteren Decke über den Schultern an einer windgeschützten Stelle so gut es ging gemütlich gemacht. Aber halt nur „so gut es ging“. Wirklich gemütlich war ihm nicht. Mit klammen Fingern drehte der Leiter des Amrumer Naturschutzzentrums den Becher von seiner Thermosflasche, öffnete den Verschluss und schenkte sich vorsichtig ein. Viel sehen konnte er dabei in der Dunkelheit nicht. Er machte es mehr nach Gefühl. Das Licht des nahen Leuchtturms, das in regelmäßigen Abständen den Himmel über ihm streifte, drang nicht bis zu ihm herab.
Der Kräutertee duftete herrlich, und das dünne Metall des Bechers leitete die Wärme wohltuend in seine Hand weiter. Als dann die ersten zaghaften Schlucke auch Mund und Kehle wärmten, war ihm gleich wohler. Ein wenig zumindest, denn es war nicht nur die Kühle der Nacht, die an seinem Wohlbefinden nagte. Noch viel mehr als das war es die Einsamkeit, in der er hier ausharren musste. Er fühlte sich nachts allein in der Natur nicht wohl. Aber Timo hatte keine Zeit gehabt, ihn zu begleiten. Er hatte Karten fürs Stadttheater Flensburg, wohin er, wie er gesagt hatte, gleich aufbrechen würde. Und Lizzy hatte sich schlichtweg geweigert.
»Du weißt, was ich von deinem Krötenprojekt halte«, hatte sie auf seine Bitte um Begleitung hin unverblümt erwidert. »Den Unfug kannst du alleine durchziehen, wenn du den schon unbedingt weitertreiben willst.«
»Dann muss ich mir wohl überlegen, ob du hier noch weiterhin arbeiten kannst«, hatte er aus einem Gefühl der Verletzung heraus entgegnet und seine Worte bereut, noch bevor sie verklungen waren. Doch da war es bereits zu spät, etwas daran zu ändern.
»He warte!«, hatte er ihr noch hinterhergerufen, als sie davongerauscht war.
Aber sie hatte sich nicht einmal mehr umgedreht. Er würde sich gleich morgen in aller Form bei ihr entschuldigen müssen, um diese Woge zu glätten. Am besten sogar mit Blumen. Nach den langen Jahren der engsten vertrauten Zusammenarbeit hätte ihm das nicht passieren dürfen.
Wie schade, dass das Krötenprojekt sie in den letzten Monaten so sehr auseinandergebracht hatte, dachte er. Daran festhalten wollte er dennoch. Wäre ja noch schöner! Schließlich war er hier der Chef und sieinzwischen nur noch eine ehemalige feste Mitarbeiterin, die sich mit einem Minijob ein bisschen was zur Rente hinzuverdiente, dachte er bissig. Sie sollte doch froh sein, dass er sie überhaupt weiter beschäftigte!
Aber das kaufte er sich nicht einmal selber ab. Er war sich durchaus bewusst, dass Lizzy Hochkamp immer noch die Seele des Naturschutzzentrums war. Sie hatte Timo zwar als ihren Nachfolger eingearbeitet, bevor sie in Rente ging, doch war sie auch danach für sie alle unentbehrlich geblieben. Die paar Kröten, die sie dafür bekam, waren sicherlich nicht ihr Motiv.
Beim Gedanken an „die paar Kröten“ machte sich auf dem Gesicht von Lauritz Frohnwein ein schiefes Grinsen breit. Schon komisch, diese doppelte Bedeutung des Wortes, fand er. Denn um „ein paar Kröten“ ging es auch ihm bei diesem ganzen Streit. Erdkröten nämlich. Die wollte er hier, an der Wittdüner Vogelkoje, ansiedeln. In den Dünentälern beim Leuchtturm war das seinem Team schon mit Kreuzkröten prima gelungen. Da hatte auch Lizzy noch brav, wenn auch nicht gerade enthusiastisch, mitgezogen. Bei seinem nächsten Plan, nun auch noch Erdkröten an der Vogelkoje heimisch zu machen, hatte sie sich dann aber quergestellt. Kompletter Blödsinn sei es, hier alle Pflanzen plattzumachen, um noch einer weiteren Krötenart den idealen vegetationsarmen Lebensraum zu bieten. Da sollte man sich lieber überlegen, wie sich das Gewässer stärker als Siedlungsgebiet für Vögel aufwerten ließe. Jedenfalls brauche es auf Amrum nicht noch mehr von diesen nervtötend lärmenden Amphibien. Die Kreuzkröten in den Dünen seien doch mehr als ausreichend.
Und so hockte er nun mutterseelenallein an diesem vor weit über 100 Jahren angelegten Tümpel, um zu erforschen, welche Tiergruppen hier in der Dunkelheit aktiv waren. Und ja, er war froh über die Büsche, die ihm ein wenig Schutz vor dem eisigen Wind aus Nordwest boten. Aber er war ja auch keine Kröte.
Der Biologe schenkte sich noch einmal Tee nach und genoss es, wie wohlschmeckend und wärmend er Mund und Magen füllte. Er blickte zum Himmel hinauf, wo die Wolkendecke immer mal wieder aufriss. Wenn sie das tat, bahnte sich das Licht des Halbmondes den Weg hinab und tauchte die Umgebung für diesen Moment in ein weißlich fahles Licht, bevor die nächste Wolke den Vorhang wieder zuzog und die schwarze Nacht zurückbrachte.
Frohnwein freute sich über das Licht. Die tiefe Dunkelheit um ihn herum wurde ihm zunehmend unheimlich. Aber für sein Vorhaben war er nicht unbedingt darauf angewiesen, etwas zu sehen. Das Forschen sollte heute Nacht weitgehend mit dem Gehörsinn stattfinden. Und falls er sich doch einmal vergewissern müsste, welches Tier er da gehört hatte, hätte er ja seine Stabtaschenlampe. Im Moment ließ er die jedoch lieber aus. Er wollte ja kein Nachttier verschrecken.
Ein laut platschendes Geräusch im Teich, dessen schwarz glänzende Oberfläche gut drei Meter unterhalb seines Sitzplatzes lag, ließ Lauritz Frohnwein auffahren. Merkwürdig, wie nervös er reagierte, wunderte er sich. Sein Puls raste. Dabei war es doch nur ein springender Fisch gewesen. Die Dunkelheit war ihm heute wohl noch unheimlicher als sonst, gestand er sich ein. Im gerade wieder durchbrechenden Mondlicht sah er, wie sich kleine Wellen im Kreis um die Stelle ausbreiteten, von der das Geräusch gekommen war. Sie würden untersuchen müssen, welche Fische genau in der Vogelkoje lebten, schrieb er auf seinen inneren Notizblock. Fische sind sehr gut für die Fortpflanzung der Erdkröten. Sie rühren die bitter schmeckenden Kröteneier nicht an, halten aber die Fressfeinde in Schach.
Der Chef des Naturschutzzentrums versuchte, sich wieder zu entspannen. Ganz wollte ihm dies aber nicht gelingen. Das Blut pochte weiterhin spürbar und auf irgendwie ungewohnte Weise in seinen Adern.
Auf der kaum 100 Meter entfernten, aber durch ein kleines Wäldchen vollständig dem Blickfeld entzogenen Inselstraße rauschte ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Auch das ließ den Biologen erschreckt zusammenzucken.
Der Lärm überlagerte für eine Weile die wenigen nächtlichen Tiergeräusche um den Teich herum. Doch wenig später kamen sie schon zurück. Aus der Ferne – es war, wie er wusste, mindestens einen Kilometer weit weg – hörte er die Balzrufe seiner geliebten Kreuzkröten. Die ersten der Saison. Er lächelte. Ja, sie waren laut, das ließ sich nicht leugnen. Aber was gab es denn schöneres auf Erden als das werbende Knurzen der Krötenmänner, das den Frühling einläutete. Wie herrlich wäre es, wenn das bald auch hier, an der Vogelkoje, seinen Widerhall im Gesang der Erdkröten fände. Zu ihrer ursprünglichen Bestimmung, dem Entenfang, hatte diese Anlage, anders als die Vogelkoje in Nebel, ja ohnehin nie wirklich getaugt. Auch heutzutage zog sie, aus welchem Grund auch immer, kaum Vögel an. Noch ein Pluspunkt für die Erdkröte! Warum nur konnte Lizzy seine Freude daran nicht teilen? Es wäre so schön gewesen, dieses Projekt, wie all die anderen zuvor, mit ihr gemeinsam in die Wege zu leiten.
Der erneut aufflammende Gedanke an Lizzy und an ihren zutiefst verletzten, tödlich beleidigten Blick, als er ihr mit Kündigung drohte, kam unmittelbar zurück und schnürte ihm das Herz ab. Er spürte körperlich, wie ihm der Streit mit der Kollegin zusetzte. Instinktiv tastete er in seiner Tasche nach der Packung mit den Herztabletten, ohne die er sich schon seit Jahren nicht mehr aus dem Haus traute. Was er fühlte beziehungsweise nicht fühlte, versetzte seinem Herzen augenblicklich einen weiteren Stich. Die Schachtel war nicht in seiner linken Manteltasche. Auch in der rechten fand er sie nicht. Frohnwein sprang auf, taumelte, stolperte und wäre um ein Haar den Abhang hinunter ins Wasser gefallen. Im letzten Moment erfasste seine suchende Hand die Zweige eines Busches. Er fand in einen sicheren Stand zurück, atmete schwer, versuchte, sich zu beruhigen. Es dauerte eine Weile, bis ihm das halbwegs gelang.
Sich mühsam und mit wenig Erfolg zur Ruhe zwingend, knöpfte er seinen Mantel auf und tastete die Innentaschen ab. Na also, da war es ja, das Pappschächtelchen, stellte er beruhigt fest. Er öffnete es und zerrte eines der beiden Blistertrays heraus. Seine Finger tasteten in der Dunkelheit nacheinander alle zehn Ausstülpungen des Pillenträgers ab. Sie waren leer. Noch nervöser als zuvor zog er den zweiten Blister heraus, tastete… auch hier enthielt keine der Mulden eine Tablette. Panik erfasste ihn. Das machte das Gefühl in seiner Brust noch schlimmer. Verzweifelt versuchte er, sich doch noch zu beruhigen.
»Lass alles stehen und liegen, und geh ganz, ganz langsam nach Hause«, sagte er zu sich selbst. »Es wird nichts passieren. Alles ist gut. So schnell gibt dein Herz doch nicht auf.«
Aber das Herz raste, die Atmung wollte nicht ruhiger werden, und wieder war er drauf und dran, das Gleichgewicht zu verlieren, was zu noch mehr Panik führte.
Das Blut rauschte laut in Frohnweins Ohren. Trotzdem hörte er das Platschen im Teich. Es war direkt vor ihm. Kein Plitsch wie vorhin, nein, eher ein Plomp. Ein großes, lautes, wirklich ganz enormes Plomp mit vielen Spritzern drum herum. Erkennen konnte er nichts. Die Wolken hatten den Mond wieder verdeckt.
»Was schert dich dieses Plomp«, schimpfte er sich. Er sollte sich einfach nur beruhigen und auf den Weg machen, nach Hause, wo es Licht gab und Wärme und eine frische Packung mit Herztabletten. Wie konnte er nur mit einer leeren Schachtel in diese Nacht hinein aufbrechen. Das war ihm doch noch nie passiert!
Frohnwein machte einen ersten Schritt. Ein Kichern ließ ihn erstarren, bevor er den zweiten hinterhersetzen konnte. Es war kein lustiges Kichern, das er gehört hatte. Es war ein fieses, ein bedrohliches, ein kaltes und zutiefst unheimliches Kichern. Es klang wie nicht von dieser Welt und rief ihm all die Geschichten um Geister und Spukgestalten in den Kopf, die hier auf Amrum seit Jahrhunderten kursierten. Als Wissenschaftler hatte er vergeblich versucht, sie als Spökenkram abzutun. Sein Kleinhirn hatte ihm dazu ganz etwas anderes erzählt und ihm in düsterer Umgebung nur allzu oft einen eisigen Schauder die Wirbelsäule hinuntergejagt. Und jetzt fühlte er, wie ihn dieses entsetzliche Kichern mit eisiger Hand im Nacken packte. Seine Haare standen senkrecht zu Berge, das Herz verkrampfte sich noch einmal mehr.
Frohnwein tastete im Mantel nach seiner Taschenlampe. Nur mit äußerster Willensanstrengung gelang es ihm, sie zu packen und herauszuziehen.
»Das Kichern hat eine natürliche Ursache, es gibt keinen Spuk«, flüsterte das dünne Stimmchen seines Verstandes, das durch das Gebrüll der Angst in seinem Inneren jedoch kaum noch zu hören war. »Was real ist, ist nicht unheimlich! Schau einfach hin.«
Er schaltete die Taschenlampe ein und richtete ihren grellen Strahl auf den Busch direkt vor ihm. Das Blut gefror ihm in den Adern. Die Lampe fiel ihm aus der Hand, rutschte den Hang hinunter und landete platschend im Teich, wo sie als schnell schwächer werdender Lichtkegel versank.
Ein ungeheurer Schmerz drückte Frohnweins Brustkorb zusammen. Er versuchte zu atmen, es gelang ihm nicht. Beide Hände an die Rippen gepresst, sank er auf die Knie, verharrte so für einen Augenblick taumelnd. Dann fiel er vornüber mit dem Gesicht in den Sand.
– 2 –
Das Meer war so gänzlich anders als die Nordsee. Meterhohe Wellen mit faszinierend glatten, kaum gekräuselten Oberflächen rollten in weitem Abstand voneinander heran. Ihr Anblick erinnerte an eine sanfte Hügellandschaft, doch dieser freundliche Ausdruck wandelte sich, wenn sie mit brechender Kraft auf die vorgelagerten Klippen trafen.
Der Ozean leuchtete azurblau wie ein Swimmingpool, und auch seine Temperatur fühlte sich für Hark Petersen eher wie ein Pool an. Schon jetzt, zu Frühlingsbeginn, erschien ihm das Wasser des Atlantiks wärmer als die heimische Nordsee im Hochsommer. Diese Empfindung mochte aber auch an der erstaunlichen Kraft der subtropischen Mittagssonne liegen, die seinen braungebrannten Rücken wärmte.
In entspannter Urlaubsstimmung blickte der Kriminalhauptkommissar den heranrollenden Wellen entgegen. Er hoffte auf die eine große, die ihn von der Mauer, auf der er stand, herunterreißen und in das dahinter liegende Becken des Schwimmbades werfen würde. Die kleinsten der Wellen verloren ihre Kraft schon an den schwarzen Vulkanklippen vor der Mauer und umspülten gerade mal seine Füße, die auf dem groben Waschbeton einen festen Halt gefunden hatten. Die etwas größeren schafften es gelegentlich, die Klippen zu überwinden und mit ihrer auslaufenden Kraft gegen seine Knie, manchmal sogar gegen die Oberschenkel zu branden. Bei den wenigen anderen Badenden, die um ihn herum die Wellen herbeisehnten, reichte dieses Heranbrausen dafür, sich laut juchzend ins Becken spülen zu lassen. Hark, der von seiner Tante Lizzy seit frühester Kindheit im Kampfsport trainiert worden war, brachten sie hingegen nicht mal ins Wanken. Er war standsicher. Da musste schon mehr kommen.
Hark wartete ruhig und geduldig. Und dann kam sie, die ersehnte Welle: groß, gewaltig, wunderschön und noch gänzlich ungebro chen. Geformt von tosenden Winden in den Weiten des Atlantischen Ozeans, hatte sie ihre Kraft über hunderte Kilometer hinweg bewahrt, um sie hier, an der rauen Felsenküste, zu entladen.
Harks in die Ferne gerichteter Blick hatte diese Welle schon früh erspäht. Deutlich überragte sie die vor ihr heranrollenden Geschwister. Fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Meter mochte sie haben. Für einen Augenblick wurde Petersen unruhig, Adrenalin beschleunigte seinen Puls. Er wog ab, wie gefährlich das werden könnte, schaute, ob der Abstand zu den anderen Badenden groß genug war, um nicht mit ihnen zusammenzuprallen, vergewisserte sich, dass keine Felsen dort lagen, wo es ihn hinschleudern würde.
Da schlug die Welle auch schon auf die Klippen auf. Sie verlor am scharfkantigen Vulkangestein nur einen geringen Teil ihrer Kraft, hob ihre Wassermassen majestätisch über die sich ihr entgegenstellende Barriere hinweg und überspülte mit ihrer anbrandenden Gischt die Schwimmbadmauer. Übermütig kreischend ließen sich die Badenden fortspülen. Auch Hark wurde mitgerissen, ließ sich hineinfallen in diese gewaltige Bewegung, spürte die ungeheure Kraft des Wassers, schmeckte das Salz, während er mit rasender Geschwindigkeit durch das Becken katapultiert wurde. Schließlich tauchte er schnaubend an die Oberfläche und ließ sich von den nun sanft auslaufenden kleineren Wellen in Richtung Beckenrand treiben.
Freddy saß dort auf ihrem dunkelroten Badetuch und blickte ihm amüsiert entgegen. Sie hatte zunächst mit ihm gemeinsam in diesem wundervollen, von Atlantikwellen durchspülten Naturbad geplantscht, dann aber genug gebadet, sich ein Eis geholt und Hark nur noch liebevoll zugeschaut. Ein kurzer Augenblick der Besorgnis, als der riesige Brecher über ihm zusammenschlug. Aber er war ein noch weit besserer Schwimmer als sie selbst. Das wusste sie und vertraute darauf.
»Boah, das war gewaltig«, lachte er und ließ sich neben sie auf das Badetuch fallen.
»Iiiih, du bist nass«, beschwerte sie sich, kichernd wie ein Teenager, als er sie dabei streifte.
Sie freuten sich riesig darüber, dass sie gestern in ihrem Hotel in Funchal das niederländische Paar getroffen hatten. Es hatte ihnen von dieser wundervollen Badestelle in Porto Moniz erzählt und ihnen auch sagen können, wann die Gezeiten optimal für das perfekte Badeerlebnis sein würden. Bei Niedrigwasser konnten die Wellen oft nicht bis ins Badebecken vordringen, bei Hochwasser konnte es leicht mal zu viel des Guten werden. Dann würde das Schwimmbecken gesperrt.
»Um die Mittagszeit wäre es morgen perfekt«, hatten sie ihnen gesagt.
Und so waren Frederike und Hark dann mit ihrem Leihwagen rechtzeitig in den äußersten Nordwesten Madeiras aufgebrochen. Sie hatten die in unwirklichen Nebel gehüllte Hochebene der Insel durchquert und im Anschluss die fantastische Fahrt auf der nördlichen Küstenstraße genossen.
Hark war ursprünglich nicht sehr erbaut von Freddys Vorschlag gewesen, nach Madeira zu fliegen. Man hätte doch auch zwei wundervolle Wochen bei Tante Lizzy auf Amrum verbringen können. Aber Frederike wollte nach dem ewig langen, schmuddelig-feuchten Winter endlich mal wieder ein wenig Sonne und Wärme tanken. Sie überzeugte ihren Mann schließlich damit, dass Madeira im März ja nur warm, aber keinesfalls heiß sein würde und dass er doch auch mal etwas von der Welt sehen müsse.
Nun freute sie sich, dass auch er den Urlaub in vollen Zügen genießen konnte. Sie waren gemeinsam durch Funchal gestreift und schon drei Mal mit den berühmten Schlitten von Monte hinunter in die Hauptstadt gerast. Sie hatten in der Markthalle die Espada genannten Degenfische bestaunt, jene gruselig anmutenden Tiefseebewohnern, aus deren Mäulern Dutzende gefährlich spitzer Zähne ragten und die hier in fast jedem Restaurant auf der Speisekarte standen. Sie hatten eine Fülle von Früchten bewundert, von deren Existenz sie bis dahin nicht einmal etwas geahnt hatten. Da gab es als „Ananas-Bananen“ angepriesene grüne Philodendron-Früchte, die in ihrem Aussehen an Tannenzapfen erinnerten. Sie lagen neben orangefarbenen „Maracuja-Bananen“ und gelblich-grünen „Piminelas“. In dieser Nachbarschaft erschienen Chirimoya, Guave, Papaya und all die anderen auf der Insel geernteten Exoten fast wie Allerweltobst, fanden sie.
Freddy und Hark kauften einige dieser Früchte und ließen sie sich am nahegelegenen Hafen schmecken, wo sie, mit herunterbaumelnden Füßen auf einer Mauer sitzend, dem Treiben um sich herum zuschauten. Den Espada genossen sie eines Abends im Restaurant. Er war weit schmackhafter als sein gruseliges Aussehen es hätte erwarten lassen. Dazu ein eisgekühlter Vino Verde – das Leben konnte so herrlich sein.
Aber die unbeschwerte Freude konnte sich auch ganz schnell wieder wenden. Kichernd und sich neckend wie ein jungverliebtes Paar, hatten Freddy und Hark die Badeanstalt verlassen und waren zum Parkplatz zurückgekehrt. Dass etwas nicht in Ordnung war, bemerkten sie erst, als sie den Kofferraum aufschlossen. Bevor sie ins Schwimmbad gegangen waren, hatten sie ihre Wertsachen darin verstaut: Handys, Kreditkarten, Bargeld. Sie wollten das alles lieber nicht mit hinein nehmen. Nur Autoschlüssel und Ausweise. Das war offenkundig keine gute Idee gewesen.
»So ein Mist«, fluchte Hark.
Die Handys waren weg, stellte er bei einer ersten schnellen Inspektion fest. Das Bargeld hatten die Täter aus den Portemonnaies geholt, die Geldbörsen selbst und die Kredit- und EC-Karten darin aber zurückgelassen.
»Irgendwie ja nett von denen«, kommentierte Frederike, die den ersten Schreck bereits überwunden hatte.
Sie hing an ihrem Portemonnaie, das Hark ihr vor Jahren mal zu Weihnachten geschenkt hatte.
Hark untersuchte das Kofferraumschloss.
»Nicht aufgebrochen«, stellte er fest. »Die hatten offenbar einen Nachschlüssel gehabt.«
»Oder haben sich unseren Schlüssel geschnappt, während wir zusammen im Wasser waren«, merkte Freddy an.
»Das kann auch sein«, stimmte er zu. »Obwohl… warum hätten sie den Schlüssel hinterher zurückbringen sollen?«
»Polizei?«, fragte Freddy.
»Hilft nichts. Das bringt die Sachen zwar nicht zurück, aber es ist ja mein Diensthandy. Das muss ich zuhause belegen. Magst du in dem Restaurant da drüben fragen, wo hier die Polizeistation ist?«
Obwohl er in den letzten anderthalb Jahren in der Volkshochschule fleißig Englisch gelernt hatte, ging Hark die Sprache noch nicht wirklich flüssig über die Lippen. Das Reden mit Fremden überließ er im Ausland daher lieber seiner Frau.
Der Kellner hatte keine Ahnung, wo die Polizeistation sein könnte, holte aber den Wirt. Der fragte mitfühlend, was denn passiert sei, schüttelte dann noch mitfühlender den Kopf und versicherte, dass das hier ja noch nie vorgekommen sei und es ihm ganz schrecklich leidtue. Dann beschrieb er ihr genau den Weg zur Station der hier „Polícia de Segurança Pública“ oder kurz „PSP“ genannten Polizei.
»Ganz einfach zu finden: keine 200 Meter von hier am südöstlichen Stadtrand.«
Die beiden ließen ihr Auto stehen und gingen den vom Wirt beschriebenen Weg zu Fuß. Der zweispurige Kreisel, an dem die Station liegen sollte, war leicht zu finden. Auch das Gebäude selbst. Doch es kam ihnen nicht wie eine Polizeistation vor. Weit und breit war kein Polizeiauto zu sehen, und auch das Schild „Policia“ entdeckten sie erst, als sie den Kreisel ein zweites Mal umrundet hatten und die Fassade des freundlich und modern wirkenden Gebäudes aus einiger Entfernung betrachten konnten.
Englisch brachte Freddy hier nicht weiter. Der Uniformierte hinter dem Tresen ließ sich ihre Ausweise zeigen, lächelte freundlich, verstand aber kein Wort. Hark griff instinktiv in die Tasche, um sein Handy fürs Übersetzen zu nehmen. Dann schüttelte er über sich selbst den Kopf: Wie blöde: Deswegen waren sie ja hier.
Der Polizist machte eine entschuldigende Geste, telefonierte, legte auf, telefonierte erneut und sagte dann »Um momento por favor«, was Hark sich auch ohne Handy mühelos mit »einen Moment, bitte« übersetzen konnte.
Es dauerte tatsächlich nur einen Moment, dann kam ein stämmiger, weißhaariger Mann in hellblauem Polizeihemd mit hochgekrempelten Ärmeln durch eine Seitentür in den Raum. Er stellte sich in fast akzentfreiem Deutsch als Dienststellenleiter Luan Oliveira vor, bat sie in den Nebenraum, aus dem er gerade gekommen war, und bot ihnen die beiden Stühle vor seinem Schreibtisch an. Er selbst ließ sich betont lässig in den breiten Bürostuhl hinter dem Schreibtisch fallen.
»Das kommt hier nicht gerade häufig vor, ist aber leider auch kein Einzelfall mehr«, erklärte Oliveira, nachdem die beiden ihm ihr Problem geschildert hatten, und breitete bedauernd die Arme aus. »Die Täter konzentrieren sich sonst eher auf die Hauptstadt und einige Orte an der Südküste. Aber diese Woche gab es auch hier am Schwimmbad ein paar Fälle. Wie genau sie es machen, wissen wir noch nicht. Es trifft immer nur Leihwagen, die Schlösser sind immer unbeschädigt, und sie nehmen nur das, was sie verwerten können: vor allem Bargeld und Dinge, für die sie Lösegeld erzielen wollen.«
»Lösegeld?«, staunte Petersen.
»Ja, ich würde es so nennen. In fast allen dieser Fälle haben die Diebe nach kurzer Zeit zu den Bestohlenen Kontakt aufgenommen, in ihren Hotels, und ihnen ihre eigenen Handys und Ausweise zum Rückkauf angeboten. Manche scheinen zu bezahlen, weil es lästig ist, sich neue Ausweise zu besorgen oder weil ihnen die Daten auf ihren Handys wichtig sind.«
»Bei der Übergabe müsste man sie aber doch schnappen können«, überlegte Petersen.
»Theoretisch ja, Herr Kollege. In der Praxis ist es uns aber nie gelungen. Ich gebe Ihnen meine Handynummer mit. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen jemand Ihre Handys zum Kauf anbietet. Vielleicht haben wir ja dieses Mal Glück.«
Petersen erklärte sich einverstanden.
»Wie kommt es eigentlich, dass Sie so hervorragend Deutsch sprechen?«, fragte Freddy noch, als sie sich verabschiedeten.
»Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und erst nach der zehnten Klasse mit meinen Eltern nach Madeira zurückgekehrt, als meine Großeltern Pflege brauchten«, erklärte er und fügte lachend hinzu, »Inzwischen spreche ich aber auch ganz passabel Portugiesisch«.
»Ist alles nicht so schlimm, dass es uns die Laune verderben müsste, oder?«, sagte Freddy auf dem Rückweg zum Auto und knuffte Hark in die Seite.
Er zögerte kurz und knuffte sie lachend zurück.
»Nö, halb so wild. Wir haben noch unsere Ausweise und Kreditkarten. Das Restaurant vorhin hatte doch eine super Terrasse mit Meerblick. Komm, ich lad dich zum Essen ein, und wir vergessen das Ganze erst einmal.«
– 3 –
»Er hatte wohl einen Herzanfall«, meinte Dr. Sebastian Schulz, während das Rettungswagen-Team seinen schwergewichtigen Patienten mit Hilfe der hinzugerufenen Polizisten auf eine Trage bettete. »Aber er wird es sicherlich überleben. Schlimmer als das Herzproblem scheint mir die Unterkühlung zu sein. Dr. Frohnwein hat offenbar eine ganze Zeitlang hier gelegen.«
Christiano Rodriguez Querra da Silva, der Dienststellenleiter der Polizeistation Amrum, der von Kollegen und den meisten Insulanern verkürzt, aber respektvoll „Tiano“ genannt wurde, notierte sich die Aussage.
»Irgendwelche Anzeichen für Fremdeinwirkung?«, fragte er dann.
»Sieht mir erst einmal nicht so aus«, erwiderte der Arzt. »Ich denke, dass es nicht gegen meine Schweigepflicht verstößt, wenn ich sage, dass ein Herzanfall bei ihm nicht aus heiterem Himmel kam. Das zeigt allein schon die Medikamentenschachtel, die hier neben ihm lag. Merkwürdig ist es aber schon. Das Medikament hätte diesen Anfall eigentlich verhindern sollen.«
»Ist Frohnwein Ihr Patient?«
»Ja, ist er.«
»Der Hubschrauber ist in fünf Minuten da«, unterbrach Polizeiobermeister Heinrich Dammann das Gespräch und steckte sein Funkgerät wieder in die Gürteltasche.
»Ich weiß nicht so recht, wie wir ihn hier rausbringen können«, sagte die Rettungswagenfahrerin und sah ihren Kollege ratlos an. »Er wiegt locker 90 Kilo, wenn nicht mehr. Mit dem RTW kommen wir nicht mal in die Nähe und die Fahrtrage können wir hier im Gelände auch nicht einsetzen.«
Dammann suchte den Blick seines Kollegen Leif Hansen, der ebenso hochgewachsen war wie er selbst und das, was er an Körperfülle weniger hatte, mit durchtrainierten Muskeln und jugendlicher Kraft spielend wettmachte. Leif verstand sofort und nickte zustimmend. Dann trugen die beiden den immer noch bewusstlosen Patienten durch das Gelände zum nächsten Weg als wöge er nichts.
Als Dr. Lauritz Frohnwein wenig später in der Inselklinik in Wyk auf Föhr wieder zu Bewusstsein kam, erinnerte er sich an… alles. Nur war er sich gar nicht so sicher, dass es wirklich passiert war. Eher wie ein Traum, ein Albtraum, erschien ihm nun das fiese Kichern, das er zu hören geglaubt hatte. War da wirklich diese Schattenfigur mit der grellweißen Horrormaske, die ihn endgültig in Panik versetzt hatte? Oder war er eingenickt und hatte all das nur geträumt?
Diese Maske mit riesigen Augenhöhlen und einem noch größeren Loch als Mund kannte er. Er hatte sie schon vorher mal gesehen – auf Bildern zu Filmen, die er niemals guckte. Die er aus gutem Grund nie guckte: Er hatte es auch ohne Horrorfilme schon schwer genug, sich nicht im Dunkeln zu gruseln. Dass er sich dennoch hin und wieder nachts allein in die Amrumer Landschaft aufmachte, war lediglich seiner eisernen Disziplin zu verdanken. Er gestand sich die Furcht vor Dingen, die es aus seiner wissenschaftlichen Sicht gar nicht geben konnte, einfach nicht zu. Besser gesagt, er gestand sich die Furcht zu, aber nicht, ihr nachzugeben. Das Amrumer Motto „Leewer duad üüs Slaaw“ hatte er mit „Lieber tot als Sklave meiner Ängste“ auch zu seinem eigenen Leitspruch gemacht. Das hatte über die Jahre und Jahrzehnte leidlich gut funktioniert. Nach diesem Erlebnis – oder Traum, was auch immer es gewesen war – würde es künftig schwieriger werden. Das ahnte er schon jetzt.
»Moin. Ich soll klingeln, wenn de wach bist. Biste wach?«
Der Mann im Bett neben seinem war ungefähr in seinem Alter. Vielleicht hatte er aber auch schon ein paar Jahre mehr drauf. Frohnwein war beim Alter schätzen nicht so gut.
»Jo«, antwortete er noch etwas benommen. »Scheint wohl so. Wo bin ich denn hier?«
»Krankenhaus Föhr. Hast wohl nich viel von mitgekriegt, oder? Hattest ’nen Herzinfarkt oder so. Aber keinen schlimmen, wie’s aussieht. Kannst bald wieder raus. Ich bin übrigens der Gerd und darf auch bald wieder nach Hause. Bin von Hooge.«
Frohnwein stellte sich als Lauritz vor, obwohl er es mit dem Duzen eigentlich nicht so hatte. Einer Weiterführung des Gesprächs entging er dadurch, dass in diesem Moment eine Krankenschwester ins Zimmer kam, ihn nach seinem Befinden fragte, seinen Puls fühlte, Blutdruck und Temperatur maß und dann zwei der drei schweren Decken, die über ihm lagen, zur Seite nahm.
»Na, die Temperatur ist ja schon wieder rauf«, lachte sie ihn dabei an. »Da kann ich Sie mal hiervon befreien, bevor Sie uns noch verglühen.«
Frohnwein fühlte sich gleich deutlich erleichtert. Ein Teil der gedrückten Stimmung, die er gerade empfunden hatte, schien vom Gewicht der Decken gekommen zu sein. Er schaffte sogar schon ein Lächeln, als er sich bedankte.
»Was ist denn passiert?«, wollte er wissen.
»Sie hatten einen Herzanfall und lagen wohl mehrere Stunden lang bewusstlos im Freien, hab ich gehört. Nicht so gut, jetzt im März. Ein Hund hat Sie zum Glück gleich früh am Morgen gefunden. War mit seinem Herrchen unterwegs. Sonst hätte das trotz der warmen Kleidung schiefgehen können. Aber nun sind Sie ja schon wieder auf Betriebstemperatur.«
»Und das Herz?«
»Das erklärt Ihnen nachher alles der Doktor. Aber machen Sie sich keine Sorgen. So schlimm ist das wohl nicht.«
»Mann, das is’ ja ’n Ding«, grinste Bettnachbar Gerd, als die Schwester den Raum verlassen hatte. »Da legt ’s dich mitten in der Natur flach. War ’n büschen leichtsinnig, oder? Mich hat’s beim Einkaufen hier auf Föhr umgehauen. Da war ich sozusagen schon fast an der Quelle.«
»Na, wenn man sich das aussuchen kann«, antwortete Frohnwein mit verkniffenem Lächeln. »Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich auch den Supermarkt in Wyk genommen.«
Die Schwester kam erneut, diesmal mit Rollstuhl, um ihn zum EKG zu bringen. Er wollte lieber selber gehen, aber das ließ sie nicht zu.
»Gern auf dem Rückweg, falls alle Werte gut sind«, versprach sie ihm.
Die Werte waren gut – oder zumindest soweit in Ordnung – und Frohnwein fühlte sich eigentlich schon wieder ganz passabel, wenn auch noch ein wenig kraftlos.
»Die Polizei hatte uns gebeten Bescheid zu geben, wenn Sie wieder ansprechbar sind«, erklärte ihm die Schwester, kurz bevor sie das Zimmer erreichten. »Das würde ich denn jetzt mal tun.«
»Wieso denn Polizei?«, fragte ihr Patient irritiert.
»Keine Ahnung, aber das werden die ihnen dann sicherlich sagen.«
»Reine Routine«, lächelte Leif Hansen, als Frohnwein ihm genau die gleiche Frage stellte.
Er hätte diese Routine auch den Föhrer Kollegen überlassen können, aber jetzt, im März, war auf Amrum überhaupt nichts los, was einen Polizisten hätte beschäftigen können. So nutzte der ehemalige Kriminalmeister und jetzige Polizeimeister die Gelegenheit, sich auf sein Fahrrad zu schwingen und via Fähre zur Klinik auf der Nachbarinsel zu fahren. Könnte ja sein, dass doch noch ein Fall daraus wird, hoffte er.
»Können Sie mir sagen, was letzte Nacht passiert ist?«, begann er die Befragung.
Dr. Lauritz Frohnwein dachte einen Augenblick lang nach, bevor er den Kopf schüttelte und »lieber nicht« brummelte.
»Wie bitte«, fasste Hansen nach, der sich nicht sicher war, das eben richtig verstanden zu haben.
»Lieber nicht«, wiederholte Frohnwein, darum bemüht, deutlicher zu sprechen.
»Und warum nicht?«
»Weil ich vielleicht nicht weiß, was passiert ist. Oder besser gesagt, weil ich nicht weiß, ob es passiert ist.«
»Dann erzählen Sie mir doch einfach von dem, was Ihnen zur letzten Nacht so durch den Kopf geht, und wir entscheiden uns dann später, ob wir das als Aussagen aufschreiben oder einfach eine nette Unterhaltung hatten.«
»Okay«, stimmte Frohnwein zögerlich zu. »Aber nur unter vier Augen. Können wir in die Cafeteria gehen?«
»Gibt es hier leider nicht«, schüttelte Leif den Kopf. »Aber wir dürfen bestimmt ins Schwesternzimmer. Schwester Magda und ich sind beste Freunde, seit unsere Tochter hier zur Welt gekommen ist.«
»Och Menno«, beschwerte sich Bettnachbar Gerd, als die beiden den Raum verließen.
So richtig flüssig ging dem Leiter des Naturschutzzentrums sein Erlebnis nicht über die Lippen. Immer wieder spürte er während der Erzählung nach, ob das wirklich so gewesen sein konnte oder ob er es vielleicht doch nur geträumt hatte. Das Ganze erschien ihm jetzt, während er darüber sprach, irgendwie noch unwirklicher als zuvor. Aber der Polizist hörte ihm mit sehr interessierter, freundlicher und ernster Miene zu und gab ihm zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, er nehme seine Worte nicht ernst. Das half dabei, Stückchen für Stückchen all das zu schildern, an das er sich erinnern konnte.
»Und die Aufgeregtheit, die Sie vor dem eigentlichen Ereignis gespürt hatten: Kam das bei Ihnen schon öfter mal vor?«, fragte Leif Hansen nach.
»Eigentlich nicht. Das kam auch mehr aus dem Körper als aus dem Kopf. Vielleicht wollte mein Herz damit ja schon mal eine Vorwarnung geben. Ich hab’ dann ja auch versucht, meine Herztabletten zu nehmen. Aber die Blisterpackungen waren, wie schon gesagt, beide leer.«
»Blisterpackungen?«
»Naja, diese Dinger mit Tabletten drin, die in den Pappschachteln stecken. Sie wissen schon: oben Plastik, unten Alufolie. Die heißen doch Blister, oder?«
»Keine Ahnung«, räumte Leif Hansen ein. »Nie gehört. Aber dann weiß ich jetzt ja Bescheid. Zwei davon habe ich dort auch aufgesammelt. Kam das schon öfter mal vor, dass diese Blisterdinger leer waren, wenn sie eine Tablette brauchten?«
»Nein, noch nie. Ich hätte auch schwören können, dass am Morgen, als ich zur Arbeit bin, mindestens einer der Blister noch komplett voll war. Aber vielleicht habe ich auch versehentlich eine leere Schachtel eingesteckt, nachdem ich meine Morgentablette genommen habe. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. In drei Jahren gehe ich in Rente, müssen Sie wissen.«
»Diese Maske, die Sie da beschrieben haben, kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann ich Ihnen auf meinem Handy ein Bild davon zeigen, um zu sehen, ob das so eine ist? Oder würde Sie das zu sehr aufregen?«
»Wird schon gehen. Und wenn nicht, ist hier ja schnell ein Arzt zur Stelle«, antwortete Frohnwein, und der Polizist war sich nicht ganz sicher, ob er es wirklich locker nahm oder Galgenhumor entwickelt hatte.
Leif Hansen googelte „Horrorfilm Scream“ und zeigte Frohnwein dann auf dem Handy eine Maske. Sie stammte aus einem Horrorfilm aus den 1990er Jahren, den er in seiner Jugend mal gesehen hatte, ohne viel Freude daran zu haben. Sehr brutal und auf Schockeffekte angelegt.
»Ja, das ist sie«, schnaufte der Biologe und schaute schnell aus dem Fenster hinaus auf die noch winterlich kahlen Äste der Bäume. »Und so einen schwarzen Umhang mit Kapuze hatte das Ding auch. Da leuchtete diese Fratze umso mehr. Und dann dieses Kichern; einfach grausig!«
»Wird’s gehen?«, fragte der Polizist mitfühlend und besorgt.
»Ja, ja. Ist schon wieder gut. Aber dann hab ich das wohl doch alles nur geträumt? Es wird ja wohl kaum ein Wesen aus irgendeinem uralten Horrorfilm nachts durch die Amrumer Dünen toben.«
»Ob Sie es nur geträumt haben, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber solche Masken und Umhänge sind als Faschingskostüm sehr beliebt. Auch und gerade dieses hier, glaube ich. Haben Sie Feinde? Kann es sein, dass jemand Sie ganz persönlich erschrecken wollte, vielleicht sogar zu Tode erschrecken?«
Dr. Lauritz Frohnwein dachte nicht lange nach, sondern antwortete sofort mit einem Kopfschütteln.
»Nein, überhaupt nicht. Ich lebe allein und ziemlich zurückgezogen. Meine Mitarbeiter mögen und schätzen mich. Auch sonst habe ich nie jemandem etwas zuleide getan. Mich noch nicht einmal mit jemandem gestritten. Obwohl, naja, mit einigen von der Gemeinde und aus der Politik wohl doch hin und wieder mal. Gerade jetzt wegen der Kreuzkröten. Da waren manche nicht so ganz meiner Meinung. Ach herrje, dabei fällt mir Lizzy ein. Ich wollte mich heute Morgen unbedingt bei ihr entschuldigen. Ich war gestern nicht nett zu ihr. Überhaupt nicht nett. Ich muss sie unbedingt anrufen.«
»Lizzy Hochkamp? Die Tante von meinem Chef, äh Ex-Chef, meine ich? Stimmt, die arbeitet ja im Naturschutzzentrum. Was war denn mit ihr?«
»Nichts, was die Polizei interessieren müsste. Viel zu peinlich«, wich der Biologe aus. »Aber das muss ich unbedingt ganz schnell klären. Sind wir dann fertig?«
»Sind wir. Für heute. Aber kommen Sie doch bitte, wenn Sie entlassen sind, zu uns in die Polizeistation Nebel. Dann können wir uns überlegen, was von alledem wir in ein Protokoll übernehmen. Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich gerne gleich an. Hier ist meine Karte, da steht auch meine Handynummer drauf.«
Frohnwein meldete sich schon am nächsten Tag per Telefon. Er sei jetzt gerade entlassen worden, es gehe ihm wieder gut, und er könne gerne vorbeikommen, nachdem die Fähre angelegt hat.
»Ich warte am Anleger auf Sie«, bot Leif Hansen an. »Dann fahren wir gemeinsam nach Nebel.«
Schon wenige Minuten später war er vor Ort und wartete am Fußgängerausstieg des Fähranlegers auf Frohnwein. Hochgewachsen, wie er war, in Uniform und mit Mütze, war er dort so wenig zu übersehen wie ein Leuchtturm.
»Ist das etwa Ihrer?«, stutzte der Biologe, als sie auf Leifs glänzenden schwarzen Maserati zugingen.
»Erbstück«, antwortete der Polizist knapp.
Er hatte längst die Lust verloren, ständig erklären zu müssen, warum er als einfacher Polizeimeister mal mit diesem Maserati, mal mit einem Range Rover und mal mit einem Porsche herumfuhr. Natürlich hätte sein Gehalt das niemals hergegeben, zumal er seit längerem nur noch in Teilzeit arbeitete. Die Autos gehörten ja streng genommen auch gar nicht ihm, sondern seiner Frau Christine, die sie, zusammen mit weit über 100 Wohnungen und Häusern auf den Inseln, von ihrem Bruder Sven geerbt hatte. Bei den Ermittlungen zum Tod dieses skrupellosen Immobilienhais hatten sie sich kennen und bald darauf auch lieben gelernt. Und ihretwegen hatte Leif seinen Job bei der Mordkommission in Husum, wo er an der Seite von Hark Petersen ermittelt hatte, gegen einen Posten bei der Amrumer Schutzpolizei getauscht. Bis heute war er überglücklich mit dieser Entscheidung, auch wenn ihm die Zusammenarbeit mit seinem früheren Chef und die aufregenden Fälle irgendwie fehlten. Das Leben mit Christine war immer noch eine einzige rosa Wolke.
»Hatten Sie in der Nacht Handschuhe getragen?«, fragte Hansen den Biologen, kaum dass sie am großen Besprechungstisch der Wache saßen. »Als wir Sie fanden, trugen Sie keine.«
»Nein, hatte ich nicht. Leider. Hätte ich gut gebrauchen können, es war kälter gewesen als erwartet. Warum fragen Sie?«
»Wir hatten alles, was da so rumlag, eingesammelt und in Plastikbeutelchen verpackt. Kripo-Routine. Und nach dem, was Sie mir erzählt haben, habe ich dieses Alles mal ein wenig genauer untersucht. Auch nach Fingerabdrücken. Auf der Medikamentenschachtel und der, äh, Blisterpackung waren einige wenige, so als wäre das alles nur ein einziges Mal angefasst worden. Kommt mir bei einer komplett leeren Packung irgendwie merkwürdig vor. Und auf der Thermosflasche waren überhaupt keine Fingerabdrücke. Das hier ist doch Ihre, oder?«
Frohnwein nahm die in einem durchsichtigen Plastikbeutel verpackte Flasche entgegen und betrachtete sie von allen Seiten. Zunächst eher beiläufig, dann aber mit wachsender Irritation.
»Sieht ähnlich aus wie meine, ist aber nicht meine. Gleiche Farbe, gleiches Fabrikat. Aber die hier ist ja nagelneu. Meine hat Kratzer am Deckel. Und sie ist mir mal runtergefallen. Dabei ist ein Stück Plastik abgeplatzt. Das kann ja nicht über Nacht wieder angewachsen sein. Also nein: Das hier ist auf gar keinen Fall meine Thermosflasche.«
»Aber Sie sagten, dass Sie, bevor die kichernde Maske auftauchte, Tee getrunken haben, und wir haben keine andere Flasche gefunden«, hakte der Polizist nach.
Frohnwein schaute ihn ratlos an.
»Ne, also das hier ist definitiv nicht meine.«
Leif Hansen dachte eine Weile nach.
»Mit den Fingerabdrücken war das ja schon komisch, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass bei dieser Sache etwas nicht stimmt«, sagte er schließlich.
»Tut mir ja leid. Ich hab doch gesagt, dass es irgendwie auch sein kann, dass ich das Ganze nur geträumt habe.«
»Und nach dem Traum liegt da plötzlich eine Thermoskanne ohne Fingerabdrücke, die nicht Ihnen gehört, und Ihre ist verschwunden? Ganz bestimmt nicht. Ich bin mir inzwischen völlig sicher, dass Sie nicht geträumt haben und dass Sie auch kein Zufallsopfer waren. Haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, ob Sie sich jemanden zum Feind gemacht haben könnten? So sehr, dass er oder sie Ihnen richtig schaden möchte?«
»Ja, hab ich. Die ganze Nacht. Und nein, da ist mir niemand eingefallen.«
»Haben Sie mit Lizzy telefoniert?«
»Quatsch. Ich mein, klar, hab ich. Lizzy ist immer noch ein bisschen muksch mit mir. Das hat sie mir klar gesagt, als ich sie angerufen habe. Aber als sie hörte, was mir passiert ist, war sie dann doch ganz besorgt und wieder nett, und dann hat sie nach ein bisschen Hin und Her auch meine Entschuldigung angenommen.«
»Für Tante Lizzy würde ich ohnehin meine Hand ins Feuer legen«, winkte Leif ab. »Aber wenn Sie sieverärgert haben, dann sind Sie auf die gleiche Art vielleicht auch anderswo mal angeeckt. Denken Sie doch bitte noch mal nach. Sie erwähnten da Kreuzkröten?«
»Die Kröten… ach ja. Ich weiß nicht, wie sich manche so stur stellen können bei diesen zauberhaften Wesen. Es sind so fantastische Tiere, und Amrum ist der ideale Lebensraum für sie. Früher waren die hier mal sehr weit verbreitet. Warum muss man denn da so gegen die sein.«
»Sie haben sich also doch Feinde gemacht? Wegen der Kröten?«
»Ach Feinde. Das ist so ein großes Wort. Susanna Martens, die Bürgermeisterin, war sauer wegen dem „Lärm“, wie sie es nennt, den die Kröten im Frühjahr machen. Seit wir die in den Dünen beim Leuchtturm wieder angesiedelt haben, mache sie von Ende März bis in den Mai hinein nachts kein Auge mehr zu, behauptet sie. Soll sie doch das Fenster schließen. Es ist jetzt eh kalt. Ich für meinen Teil würde die aber sogar aufmachen, um diese lieblichen Paarungsrufe zu hören.«
»Stimmt, die Bürgermeisterin hatte sich auch schon bei uns beschwert. Christine, meine Frau, hat ihr das Haus unten am Tanenwai in Süddorf vermietet. Gehört einer Cousine von ihr, die sich für sehr lange Zeit nicht mehr darum kümmern kann. Meine Frau hat Susanna das gleiche gesagt: Das sei halt Natur und sie müsse dann eben in der Brunftzeit nachts die Fenster zu lassen.«
»Das nennt sich nicht Brunft, das nennt sich Balz«, unterbrach der Biologe aufbrausend.
»Dann eben Balz. Könnte die Bürgermeisterin Ihnen die Ansiedlung so übelnehmen, dass sie Ihnen einen, sagen wir, bösen Streich spielen würde?«
»Nicht im Ernst jetzt, oder?«
»Ich würde es ihr ja auch nicht zutrauen. Aber aus meiner Zeit bei der Mordkommission weiß ich, dass man vielen Tätern die Tat niemals zugetraut hätte. Selbst wirklich nahestehende Personen nicht. Und irgendwer hat es, wie es scheint, ja getan.«
»Aber nicht die Bürgermeisterin. Und Lizzy schon mal gar nicht. Und auch sonst kann ich mir niemanden vorstellen. Ne, ich glaube nicht, dass es da jemand auf mich abgesehen hat. Wenn ich es nicht geträumt habe, muss das ein Dummejungenstreich gewesen sein.«
»Die Thermosflasche schicke ich aber trotzdem mal zur Untersuchung ein«, sinnierte der Polizist.
»Tun Sie das. Meine ist das ja ohnehin nicht.«
Als sie das Protokoll geschrieben hatten und Frohnwein gegangen war, versuchte Leif, Hark Petersen anzurufen. Sein früherer Chef würde ihm sicherlich eine Einschätzung geben können, was von diesem Fall zu halten war und wie er weiter vorgehen müsste – wenn man es denn überhaupt einen Fall nennen konnte. Aber Petersen ging nicht ans Telefon.
»Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar«, vermeldete eine Computerstimme.
– 4 –
Der Chef des Restaurants am Schwimmbad hatte Freddy und Hark so herzlich begrüßt, als wären sie alte Freunde. Dabei hatte er Frederike zuvor ja nur den Weg zur Polizeistation beschrieben. Er hatte gefragt, was bei der Polizei herausgekommen war und ungläubig den Kopf geschüttelt, als sie ihm erzählte, dass das hier in letzter Zeit wohl schon öfter mal vorgekommen war. Dann hatte er den Kellner angewiesen, ihnen den schönsten Tisch auf der Terrasse zurechtzumachen.
Der Kellner hatte sie so freundlich und zuvorkommend behandelt wie die besten Freunde des Chefs, und die Aussicht war grandios. Sie konnten über die von den Atlantikwellen jetzt komplett überrollten und daher für Schwimmer gesperrten Schwimmbecken hinweg weit hinaus auf den Ozean blicken.
Das Essen war leider ein Kontrastprogramm zu diesem schönen Ambiente gewesen. Was heiß sein sollte, wurde kalt serviert, was kalt hätte sein sollen, kam warm auf den Tisch. Mal fehlte Salz, mal war zu viel davon dran.
Das Ehepaar hatte sich die Laune dadurch aber nicht verderben lassen und angesichts der unglaublich freundlichen Behandlung auf jegliche Kritik verzichtet – was Hark nur aufgrund der Sprachbarriere leichtfiel. Sie hatten sich auf die schönen Aspekte konzentriert und anschließend eine herrliche Rückfahrt entlang der südlichen Küstenstraße genossen.
Seither waren nun anderthalb Tage vergangen, ohne dass sich jemand bei ihnen gemeldet hätte. Weder die Polizei noch irgendjemand, der „Lösegeld“ für ihre Handys gefordert hätte. Hark konnte sich auch nicht wirklich vorstellen, dass das passieren würde. „Handynapping“ statt Kidnapping, davon hatte er in seiner Polizeilaufbahn noch nie gehört.
An diesem Morgen wurde er jedoch eines Besseren belehrt. Als sie nach dem Frühstück an der Rezeption des Hotels vorbeigingen, sprach der Empfangschef Freddy an.
»There is a message for you«, erklärte er und reichte ihr einen Zettel, den er aus ihrem Schlüsselfach zog.
Freddy faltete den Zettel auseinander. Die Botschaft war auf Englisch verfasst:
»500 € for Handy, 800 for 2. Put money in trunk. Evening this. No police.«
»Oh Klasse«, sagte sie mit verkniffenem Lächeln zu Hark. »Wir bekommen Mengenrabatt, wenn wir beide Handys zurücknehmen. Das Geld sollen wir wohl heute Abend in unseren Kofferraum legen.«
Hark nahm den ziemlich zerknitterten Zettel in die Hand, wendete ihn hin und her. Ein Absender stand aber natürlich nicht darauf. Die Botschaft war mit Bleistift geschrieben. Der Verfasser hatte sich um eine sehr ordentliche Schrift bemüht.
Hark bat Freddy, den Empfangschef zu fragen, wer den Zettel abgegeben hatte. Der wusste es nicht. Es müsse wohl in der Nachtschicht gewesen sein.
»Na, dann werden wir wohl mal Oliveira anrufen«, meinte Hark, der nicht einen Moment lang in Erwägung zog, die Anweisung »No police« – keine Polizei – zu befolgen. Schließlich war er ja selber Polizist.
In ihrem Hotelzimmer gab es noch ein richtiges Telefon, so eines mit geringelter Schnur zum Hörer, einem Tastenblock zum Eingeben der Nummer und einem Kabel, das zu einer Buchse in der Wand führte.
Der Polizeichef von Porto Moniz war sofort dran. Nein, selber werde er natürlich nicht kommen, sagte er. Das sei nicht sein Revier. Aber er werde den Kollegen in Funchal Bescheid geben. Die würden sich dann bei den Petersens melden. Wann genau, könne er natürlich nicht sagen, am besten sei es, wenn sie sich im Hotel zur Verfügung hielten.
»Etwa den ganzen Tag?«, fragte Petersen irritiert.
»Wie gesagt, wann die Kollegen sich bei Ihnen melden, kann ich beim besten Willen nicht sagen.«
»Nun ja, falls wir unterwegs sind, hinterlasse ich eine Nachricht an der Rezeption.«
»Wie sie meinen«, antwortete Oliveira und verabschiedete sich.
»Ich wollte sowieso gerne mal wieder einen Tag am Hotelpool verbringen«, nahm Freddy das Ansinnen gut gelaunt auf. »Uns ganz entspannt mit Saft on the Rocks verwöhnen lassen, aufs Meer hinausschauen, die Seele baumeln lassen und hin und wieder mal ins Wasser steigen.«
»Klingt großartig«, stimmte Hark fröhlich zu und zog sie zu sich aufs Bett.
Es war eine große Hotelanlage direkt an der Steilküste, die sie für ihren Urlaub gebucht hatten. Ihr Zimmer hatte einen großen Balkon direkt zum Meer hinaus. Auch vom Pool aus schaute man, zwischen Palmen hindurch, auf die unendliche blaue Weite der See.
Liegestühle standen dicht an dicht um den Pool herum, aber jetzt, zum Frühlingsbeginn, war das Hotel nicht mal zur Hälfte ausgebucht, und die meisten anderen Gäste waren den Tag über unterwegs. Hark und Freddy hatten die Außenanlage daher fast für sich allein.
Es wurde ein traumhafter, entspannter Tag, der durch nichts unterbrochen wurde, auch nicht durch die Polizei. Bis zum späten Nachmittag hatte niemand an der Rezeption nach ihnen gefragt.
Hark ging schließlich ins Zimmer hinauf und rief erneut Luan Oliveira an. Der zeigte sich erstaunt und entschuldigte sich, dass sich die Kollegen nicht gemeldet hatten. Er versprach, sich zu erkundigen und dann gleich zurückzurufen.
Es dauerte eine ganze Weile, bis das Telefon klingelte.
»Das tut mir nun sehr leid«, bedauerte der Anrufer. »Die Sache ist dort im Revier irgendwie untergegangen. Und jetzt haben sie leider niemanden, den sie zu Ihnen schicken können. Sie würden Ihnen raten, nicht zu bezahlen, weil das die Täter zur Wiederholung ermutigen würde. Die Handys ersetzt Ihnen ja vielleicht Ihre Reiseversicherung, falls Sie eine abgeschlossen haben. Ich kann mir vorstellen, wie unbefriedigend das jetzt für Sie ist, Herr Kollege. Aber ich kann es leider nicht ändern.«
Petersen hatte Mühe, sich zu beherrschen. Er konnte zwar verstehen, dass der Diebstahl von zwei Handys für die Polizei in Funchal kein großes Ding war. Daraus hätten sie in Husum auch keine Staatsaffäre gemacht. Aber dass sie, sozusagen für nichts, den ganzen Tag im Hotel hatten bleiben sollen, das regte ihn auf. Doch nur für den kurzen Moment, den er brauchte, tief durchzuatmen.
Dann dachte er sich »Was soll’s«. Er hatte einen herrlichen Tag mit Freddy am Pool genossen, der Verlust der Handys war zu verschmerzen, und sie hatten immer noch einige wundervolle Tage auf Madeira vor sich. So verabschiedete er sich fast schon wieder gut gelaunt vom portugiesischen Kollegen und legte auf.
»Und nun?«, fragte Freddy, als er zum Pool zurückkam.
»Es wäre ja schon schön, die Handys zurückzubekommen. Das erspart mir eine Menge Papierkram auf dem Revier. Aber 800 Euro in den Kofferraum legen und darauf hoffen, dass die Diebe so nett sind, die Handys dafür zurückzulegen? Das wäre wohl ziemlich naiv.«
Freddy stimmte ihm darin zu, und so beschlossen sie, statt des Geldes einen Zettel in den Kofferraum zu legen und einen persönlichen Austausch zu fordern: Bargeld gegen Telefone. Das gäbe ihm vielleicht sogar die Möglichkeit, den Dieb bei der Übergabe festzuhalten und die Polizei zu rufen, war Harks Hintergedanke dabei. Den behielt er aber für sich. Es war ihm bewusst, dass Freddy nichts davon halten würde.
Sie ließen sich an der Rezeption einen Bogen Papier geben. Freddy schrieb ihre Botschaft darauf, bemüht, möglichst einfache Worte zu finden. Sie wollten deutlich machen, dass nur ein direkter Austausch in Frage kam und aus dem Geschäft sonst nichts würde.
»Exchange directly. Money for handy or no deal«, stand schließlich auf dem Zettel, den sie am späten Nachmittag in den Kofferraum ihres Mietwagens legten.
»Müsste es nicht Mobile Phone statt Handy heißen«, fragte Hark, der aus seinem Englischunterricht wusste, dass „Handy“ zwar Englisch klang, es aber nicht war.
»Stimmt, aber sie haben ja auch Handy geschrieben«, antwortete Freddy und blieb bei ihrer Wortwahl.
Hark war versucht, in der Nähe darauf zu lauern, wer ihren Kofferraum öffnen würde. Da könnte er dann vielleicht sogar direkt die Handys zurückerobern. Aber Freddy war total dagegen. Sie hatte nicht die geringste Lust auf „Räuber- und Gendarm-Spiele“, wie sie es nannte. Viel lieber würde sie in ein hübsches, romantisches Restaurant in der Stadt gehen und einen herrlichen Abend mit Hark genießen.
Wenn er es so recht bedachte, erschien das auch Hark selber als der wesentlich schönere Plan. Sie hatten ja unbedingt noch eines der typischen Espetada-Restaurants besuchen wollen, von denen sie in einer Broschüre im Hotel gelesen hatten. In diesen Restaurants würden die „Espetada“ genannten Fleischspieße nicht auf Metallstäben, sondern auf Lorbeerzweigen über offenem Feuer gegrillt, hieß es da. Allein das fand Freddy schon spannend. Auch die versprochene starke Würzung der Espetadas vor allem mit frischem Lorbeer und Knoblauch reizte sie.
An der Rezeption erfuhren sie, dass die besten Espetada-Restaurants nicht direkt in der Innenstadt, sondern in Estreito zu finden seien. Das war etwas außerhalb von Funchal in den Bergen. Da das Auto ohnehin als Briefkasten für die Handydiebe auf dem Hotelparkplatz bleiben musste, entschieden sie sich für ein Taxi. Das hatte zudem den Vorteil, dass beide gemeinsam den Wein der Insel genießen konnten.
»Na, die Beschreibung „etwas außerhalb“ ist wohl ein wenig verniedlicht«, grinste Hark, als der Fahrer sie nach gut 15 Kilometer Fahrt an ihrem Zielort absetzte.
Aber ansonsten hatte der Hotelportier nicht zu viel versprochen. Tatsächlich bot der kleine, von Weinbergen umrahmte Ort oberhalb der Hauptstadt nicht nur einen herrlichen Weitblick über die Landschaft, sondern auch gefühlt ein Dutzend Restaurants, von denen gleich mehrere die berühmten Lorbeerspieße anboten.
Unten, in der Altstadt von Funchal, hätten sie vermutlich nach einem Restaurant gesucht, bei dem sie draußen sitzen können. Hier oben, auf 400 Meter Höhe, war es ihnen jetzt, am Abend, aber zu kühl dafür. Sie wählten eines, bei dem sie durch die offene Eingangstür ein glühendes Holzfeuer sehen konnten, über dem bereits einige Espetadas schmorten. Ein herrlich würziger Duft, der durch die Tür zu ihnen hinaus strömte, überzeugte sie endgültig davon, dass sie hier richtig wären.
Inzwischen hatten sie auch riesigen Hunger. Ohne überhaupt erst auf die Karte zu schauen, bestellten sie ein Bolo do Caco als Vorspeise. Das über dem Feuer gebackene fluffig-knusprige Fladenbrot aus Süßkartoffelmehl wurde mit Knoblauchbutter bestrichen und war innerhalb weniger Minuten auf dem Tisch. Es verströmte einen verführerisch würzigen Duft und stillte das Knurren im Magen, während sie voller Vorfreude die Speisekarte studierten.
Freddy wählte einen Spieß mit Hähnchenfleisch, Hark entschied sich für Rind. Als Beilage bestellten sie Salat und Milho frito, jene köstlichen, in Öl ausgebackenen Maismehlwürfel, denen Kräuter einen frischwürzigen Geschmack verleihen. Ein kräftiger Rotwein begleitete die reichhaltige Mahlzeit. Seine Trauben waren nur wenige hundert Meter von hier an den Hängen von Estreito angebaut worden, erfuhren sie von der ausgesprochen freundlichen Kellnerin. Estreito, erzählte sie stolz, sei das Zentrum des Weinanbaus auf Madeira. Auch ihre Eltern seien Weinbauern. Dieser Rote aber komme von einem Nachbarn; ihre eigene Familie sei auf weiße Weine spezialisiert.
Das Essen war hervorragend zubereitet, und der zunächst ein wenig enttäuschende Wein schmeckte mit jedem Glas besser. Zwei Engländer am Nachbartisch hatten dieselbe Speisenfolge gewählt. Sie kamen miteinander ins Gespräch über die Sehenswürdigkeiten der Insel, schwärmten übereinstimmend vom Schwimmbad in Porto Moniz und vom Wandern entlang der Levadas, jener uralten künstlichen Wasserläufe, die das Wasser vom regenreichen Norden der Insel in den trockenen Süden leiteten.
Hark stellte überrascht fest, dass sein Englisch gar nicht so schlecht war, wie er gedacht hatte. Er konnte Frederikes Unterhaltung mit den beiden Männern nicht nur folgen, sondern auch selber dazu beitragen. Er beschloss, sich künftig nicht mehr so schamhaft zurückzuhalten.
Irgendwann kam das Gespräch dann auf die besonderen Erlebnisse auf der Insel. Auch hierbei gab es Übereinstimmungen. Dem englischen Paar war dasselbe passiert wie ihnen: Ausweise und Handys waren aus dem Kofferraum verschwunden, während sie an einem der wenigen Strände Madeiras badeten. Schon am nächsten Tag erhielten sie im Hotel eine „Lösegeldforderung“.
»Habt ihr bezahlt?«, fragte Hark neugierig.
Ja, das hatten sie. Wegen all der Daten auf den Handys und der zeitaufwändigen, lästigen Wiederbeschaffung der Ausweise hatten sie das Geld in den Kofferraum des Mietwagens gelegt, ohne sich viele Gedanken zu machen, ob sie dann auch tatsächlich ihr Eigentum zurückerhalten würden.
»Okay, das war vielleicht etwas blauäugig«, räumte der eine von ihnen ein.
»Aber die Diebe waren ehrlich«, fügte der andere grinsend hinzu und zeigte ihnen sein Smartphone.
Ihren Mietwagen hatten die Engländer beim selben Verleiher gemietet, erfuhr Hark noch auf Nachfrage. Der Polizist in ihm hatte das fast schon erwartet.
Nach dem üppigen Essen war kaum noch Platz im Magen für einen Nachtisch. Schon gar nicht für einen der kalorienreichen Kuchen, die auf Madeira die Dessertkarten dominieren. Aber ohne einen süßen Abschluss wollten sie den Abend trotzdem nicht beenden. Der Kellnerin war das nicht neu. Sie empfahl ihnen Pudim de Maracuja, einen Passionsfrucht-Pudding. Der schmeckte sehr gut, das wussten sie schon, war ihnen aber für diesen Anlass zu sahnig und zu wenig süß. Nach kurzer Beratschlagung entschieden sie sich daher für eine einfache Kugel Eis und einen doppelten Espresso. Schließlich orderte die Kellnerin ihnen ein Taxi.
Es war derselbe Fahrer, der sie bereits nach Estreito gefahren hatte. Er begrüßte sie freudig wie alte Bekannte, und sie erwiderten seine Freundlichkeit.
»Back home?«, fragte er nur und fuhr sie zu ihrem Hotel.
Bevor sie aufs Zimmer gingen, schaute Hark in den Kofferraum des Mietwagens. Ihre Botschaft an die Diebe lag noch unberührt darin. Achselzuckend folgte er Frederike ins Hotel.
Am nächsten Morgen war der Zettel aus dem Kofferraum verschwunden. Hark war gespannt, ob die Diebe sich auf eine persönliche Übergabe einlassen würden. Er hielt es für eher unwahrscheinlich. Viel zu groß war die Gefahr, dabei geschnappt zu werden. Aber schon am darauffolgenden Morgen gab der Empfangschef ihres Hotels ihnen einen Zettel, der für sie abgegeben worden war. Es war wieder ein einfaches, schmuddeliges, einmal gefaltetes Blatt Papier. Und auch diesmal wusste an der Rezeption niemand, wer den Zettel abgegeben hatte.
»Nachtschicht«, sagte der Hotelmitarbeiter achselzuckend zu Freddy.
Die Antwort der Diebe war einfach gehalten.
»Today 18 horas. Lobby. 800 € cash. No police«, stand auf dem Blatt.
»Na sowas«, staunte Hark, der aus der Botschaft herauslas, dass die Übergabe schon am selben Tag um 18 Uhr in der Hotellobby stattfinden sollte.
Ihnen stand diesmal nicht der Sinn danach, die Polizei einzuschalten. Noch einmal einen ganzen Tag für nichts ans Hotel gebunden sein?
»Nö, muss nicht«, kommentierte Freddy, die es heute auch zu kühl und wolkenverhangen für einen weiteren Tag am Pool fand.
Viel lieber wollten sie die Levada-Wanderung machen, die die beiden Engländer ihnen gestern Abend ans Herz gelegt hatten. Dafür schien das Wetter an diesem Tag deutlich geeigneter zu sein.
Die Engländer hatten nicht zu viel versprochen. Die empfohlene Wanderung bot eine wunderschöne Strecke entlang des Wasserlaufs. Sie kamen durch üppige Plantagen und liebevoll gepflegte Obst- und Gemüsegärten, und immer wieder boten sich herrliche Ausblicke hinunter in die Täler und hinaus aufs Meer. Zur Mittagszeit fanden sie ein kleines, einfaches Restaurant auf ihrem Weg, in dem die Zutaten der Umgebung für sie frisch vom Feld zubereitet wurden.
Bevor sie am Nachmittag ins Hotel zurückkehrten, schauten Hark und Freddy am Geldautomaten vorbei und hoben das Lösegeld für ihre Handys ab. Hark war sich zwar gar nicht sicher, dass er die 800 Euro wirklich gegen ihre Handys austauschen würde. Viel eher würde er den Dieb einfach festhalten bis die Polizei käme. Aber Freddy hielt wenig von diesem Plan.
»Es könnten ja gleich mehrere sein, vielleicht sogar bewaffnet, und sie sind auch sicherlich nicht so blöd, einfach blauäugig in eine Falle zu tappen«, meinte sie und bestand darauf, sich zumindest für eine Geldübergabe vorzubereiten.
Hark gab ihr schließlich recht, dass sein Vorhaben vielleicht zu einfach gestrickt war. Er steckte daher einen Umschlag mit exakt 800 Euro in seine Jackettasche. Dann beratschlagten sie über die Aufforderung »no police«, »keine Polizei«, und entschieden, dass sie den Kollegen in Porto Moniz zumindest informieren sollten. Es war fast 17 Uhr, da würde niemand mehr ihre Tagespläne durcheinanderwirbeln können. Aber Luan Oliveira ging nicht ans Telefon.
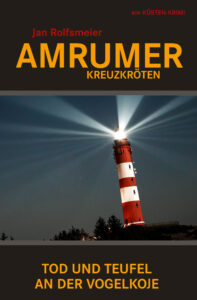 Wenn Ihnen dieser Einstieg gefällt und Sie den Küsten-Krimi als eBook für 4,99 Euro, als Taschenbuch für 11,99 Euro oder als Hardcover (je 252 Seiten) weiterlesen möchten, bekommen Sie es als eBook bei Kindle und Kindle Unlimited und gedruckt bei Amazon sowie im Online- und stationären Buchhandel.
Wenn Ihnen dieser Einstieg gefällt und Sie den Küsten-Krimi als eBook für 4,99 Euro, als Taschenbuch für 11,99 Euro oder als Hardcover (je 252 Seiten) weiterlesen möchten, bekommen Sie es als eBook bei Kindle und Kindle Unlimited und gedruckt bei Amazon sowie im Online- und stationären Buchhandel.