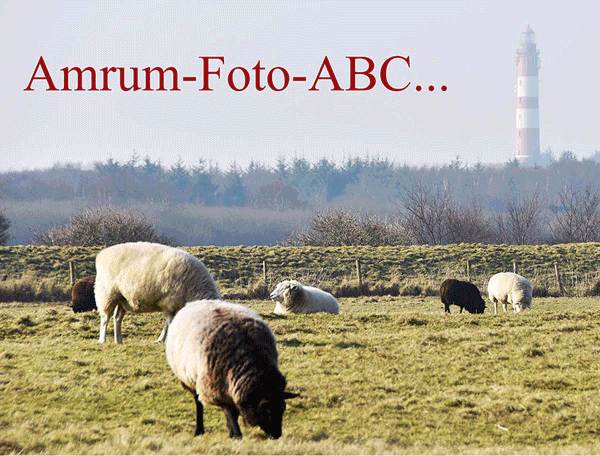Ein Strandkorb für die Leiche – Hark Petersens vierter Fall
Amrum autofrei? Immer heftiger prallen Gegner und Befürworter dieser Idee aufeinander. Rangeleien, Gemeinheiten und Vandalismus halten die Inselpolizei in Atem. Und dann spielt auch noch die Tierwelt verrückt: Möwen stürzen sich zu Tode, ein Hund dreht durch. Auf Wochenend-Besuch bei Tante Lizzy bestaunt Kommissar Petersen die Entwicklung noch mit amüsierter Distanz. Doch dann gibt es einen Toten, und der Chef der Husumer Mordkommission muss plötzlich auch beruflich zwischen den Amrumer Fronten ermitteln.
Leseprobe:
– 1 –
»So eine verfluchte… !«
Peter konnte kaum glauben, was er da sah. Von einem Moment zum anderen waren alle Pläne über den Haufen geworfen. Die Ruhe, die Entspannung, die Freude, die er empfunden hatte… alles vorbei. Statt dessen Wut und auch eine gewisse Ratlosigkeit: Was sollte er tun? Wie sollten sie jetzt nach Hause kommen? Wo würden sie bleiben können?
Er setzte die Koffer ab, schnappte nach Luft. Einmal, zweimal, dann entrann ein von der Aufregung gedrückter, krächzend quietschender Ruf seiner Kehle.
»Marie!«
Marie hörte natürlich nichts. Sie war drinnen bei den Kindern, und die Kinder waren aufgeregt und laut.
»Marie! Mariiiehiii!«
Es hatte keinen Zweck. So würde das nichts werden. Peter griff sich die beiden Koffer, die er gerade eben herausgebracht hatte, und ging mit ihnen ins Haus zurück. Dabei zwang er sich, ruhiger zu werden. Jetzt bloß nichts tun, was die Situation zusätzlich eskalieren lässt, dachte er. Auf keinen Fall die Kinder beunruhigen. Gelassenheit zeigen.
Leichter gesagt als getan. Aber er würde das schon hinbekommen.
Die Sonne schien weiterhin vom Himmel, als wäre nichts geschehen. Sie hatte ihnen bis eben einen wundervollen letzten Morgen auf Amrum beschert. Sie hatte darüber hinweggetröstet, dass ihre Amrumferien heute zu Ende gingen, und Vorfreude auf die langsam gleitende Überfahrt zum Festland geweckt, die sie auf dem Sonnendeck genießen wollten.
Diese Sonne, die von einem mit weißen Wölkchen getupften tiefblauen Himmel strahlte, hatte ihnen auch ihr letztes Frühstück auf dieser wundervollen Terrasse vergoldet. Sie genossen noch einmal den würzigen Duft des Waldes, der Kiefern. Sie lauschten ein letztes Mal dem Gesang der Vögel, dessen Echo von den Bäumen widerhallte.
Wie hatten sie diesen Duft, diese Geräusche in den letzten zwei Wochen genossen. Hier auf der Terrasse oder nachts im Bett bei geöffneten Fenstern. So schön hatten sie es zuhause in Duisburg leider nicht. Von den Dünen, dem unendlich erscheinenden Sandstrand und dem jeden Tag zu jeder Stunde gänzlich unterschiedlich wirkenden Meer ganz zu schweigen.
Diesmal hatte eine besonders tiefe Wehmut in ihrem Abschied von der Insel gelegen. Es war nicht einfach nur ihr letzter Tag in diesem Jahr auf Amrum. Vielmehr war es für lange, lange Zeit das letzte Mal überhaupt, dass sie die Insel im Frühling sehen und genießen durften. Julia würde nach den Sommerferien in die Schule kommen, Jakob in zwei Jahren. Was das bedeutete, war ebenso bedauerlich wie unausweichlich: Für mehr als zehn Jahre würden ihre Amrumaufenthalte und überhaupt jeglicher Urlaub nun von den Schulferienzeiten ihres Bundeslandes bestimmt sein. Amrum im Mai – das würden sie eine gefühlte Ewigkeit lang nicht mehr erleben können. Und ob sie hier im Sommer überhaupt ein Quartier finden würden, das sie sich leisten konnten, stand ebenfalls noch in den Sternen.
Marie schaute überrascht auf, als er mit den Koffern ins Haus zurückkam. Sie sah sofort, dass etwas nicht stimmte.
»Schaut doch schnell mal, ob noch Spielzeug in der Sandkiste liegt«, rief sie Julia und Jakob fröhlich zu.
Die beiden zischten kichernd ab.
»Was ist passiert?«, fragte sie mit ernstem Gesicht, als die Kinder außer Hörweite waren.
»Wir können nicht los«, erwiderte er mit steinerner Miene. »Das Auto ist platt. Die Reifen. Alle vier. Wir werden die Fähre verpassen. Wir werden heute nicht nach Hause kommen. Wir müssen die Polizei rufen! Wo sollen wir bleiben? Ob es auf der Insel überhaupt Reifen zu kaufen gibt?«
Jetzt war auch Marie blass geworden. Gemeinsam mit Peter ging sie zum Auto, begutachtete den Schaden. Peter hatte leider Recht. Alle vier Reifen standen auf ihren Felgen. Einstichstellen oben in ihren Mänteln machten deutlich, warum. Außerdem hatte jemand mit krakeliger Schrift „Autos raus“ in den Lack der Motorhaube geritzt. Dem Passat von Meiers, der neben ihrem Opel stand, war es ebenso ergangen. Beim Mercedes Coupé des Pärchens, das im Obergeschoss des Hauses Urlaub machte und von Julia und Jakob demonstrativ genervt war, war hingegen nur ein einziger Reifen zerstochen und nichts zerkratzt worden. Der Golf ihrer Vermieter war gänzlich unbeschädigt.
»Wer tut denn sowas?«
Marie schüttelte den Kopf und starrte grimmig auf ihr Familienauto. Die Kinder kamen kichernd angelaufen und umschlangen ihre Beine, bevor die Tochter etwas bemerkte.
»Bist du traurig, Mami?«, fragte Julia mit einem Staunen, in dem viel Beunruhigung mitschwang.
»Nein, nein, alles gut. Unser Auto scheint kaputt zu sein. Ich habe nur einen Schreck gekriegt.«
Peter hatte inzwischen umständlich sein Handy aus der Hosentasche gefischt und den Polizeinotruf gewählt. Nach dem dritten Rufzeichen wurde abgenommen.
»Sie sind leider nicht der Erste heute Morgen«, eröffnete ihm der Polizist. »Wo sagten Sie? Tanenwai, Westerheide? Alles klar. Ich schicke die Kollegen zu Ihnen. Das kann aber etwas dauern. Es gibt, wie gesagt, schon mehrere solche Fälle.«
»Wir müssen mit den Vermietern reden«, sagte Marie, nachdem Peter aufgelegt hatte.
»Ich mach das«, nickte Peter. »Bleib du am besten hier bei den Kindern, und ruf mich, falls die Polizei doch schon früher kommt.«
»Polizei, Osterei«, riefen Jakob und Julia ihm lachend hinterher. Wo mochten sie das nur wieder aufgeschnappt haben.
Die Vermieter wohnten in einem Haus, das weiter hinten auf dem Grundstück, noch tiefer in den Wald hinein gebaut worden war. Frau Borg, die Vermieterin, war gerade dabei, verwelkte Blüten aus den Geranien zu schneiden. Peter schilderte ihr, was geschehen war. Sie war entsetzt.
Gemeinsam gingen sie zum Parkplatz. Frau Borg begutachtete kopfschüttelnd die Autos, konnte und wollte nicht glauben, was sie da sah.
Auch Meiers waren inzwischen aus ihrer Ferienwohnung gekommen und betrachteten mit bitterer Miene den Vandalismus an ihrem Wagen.
»Können wir in der Wohnung bleiben, bis der Schaden behoben ist?«, fragte Peter hoffnungsvoll.
»Das ist ja schrecklich«, sinnierte Frau Borg und schüttelte erneut den Kopf. »Dass das hier auf unserer Insel passiert. Wer hätte denn sowas gedacht. Dieser Autokrieg wird immer verrückter.«
»Ja sicherlich. Ganz wie Sie meinen. Aber wie ist das? Können wir noch eine Nacht oder so hier bleiben?«
Frau Borg schaute ihn irritiert an.
»Das geht nicht«, antwortete sie barsch. »Heute Nachmittag kommen die neuen Gäste. Bis dahin muss ich alles picobello haben. Nein, tut mir leid, Sie müssen sich etwas anderes suchen.«
»Haben Sie denn vielleicht noch eine andere Wohnung frei?«, drängte Peter.
»Nein, alles belegt. Das wird jetzt auch nicht ganz einfach sein. Die Insel ist schon ziemlich voll. Am besten fragen Sie bei Amrum Touristik nach. Die wissen bestimmt, wo noch was frei ist. Aber für ein, zwei Tage ist natürlich schlecht. Und dann noch mit zwei Kindern.«
»Wissen Sie denn wenigstens, wie ich an neue Reifen komme? Am besten heute noch. Gibt es hier auf der Insel eine Werkstatt?«
»Da fragen Sie am besten mal Hinrich Christiansen. Die Tankstelle in Norddorf. Der hat auch ne Werkstatt. Macht alles, was wir hier so brauchen.«
Aus der Ferne waren Sirenen zu hören, die schnell näher kamen.
»Ah, der Neue«, stellte Frau Borg mit bitterem Lächeln fest.
Ihr Ton erschien ihm ziemlich abfällig. Peter blickte sie fragend an.
»Na, der Neue von der Polizei. Hat gerade nach Amrum eingeheiratet. Gute Partie. Der macht gerne mal die Sirenen an, so als ob es irgendwas ganz Eiliges gäbe und alle ihn durchlassen müssten. Ein bisschen zu ungestüm, der junge Herr. Der Vorgänger war ruhiger. Passte besser hierher.«
Wie zur Bestätigung kam ein Polizeiwagen mit lautem Sirenengeheul herangerast. Er bremste im letzten Moment schlitternd ab. Die blockierenden Reifen gruben sich geräuschvoll in den Sandweg. Mit einem abflauenden und sich schließlich kraftlos auflösenden Wuuuhhhhh kam die Sirene zum Schweigen.
Ein junger, hochgewachsener, unverschämt gut aussehender Uniformierter sprang auf der Fahrerseite heraus und ging zügig auf die um die Autos versammelten Menschen zu. Eine noch wesentlich jüngere Kollegin folgte ihm demonstrativ langsam von der Beifahrerseite her.
Der Mann stellte sich als Polizeimeister Leif Hansen vor, seine Kollegin als Polizeimeisterin Emma Jordan. Er ließ sich von Peter schildern und zeigen, was vorgefallen war, während die Kollegin Fotos von den geschädigten Fahrzeugen machte. Danach wandte er sich der Familie Meier zu.
Peter googelte derweil die Werkstatt, die Frau Borg ihm genannt hatte, und rief dort an.
Der Werkstattleiter klang wenig charmant, war dafür aber konstruktiv. Ja, natürlich könne er sich darum kümmern. Neue Reifen aufziehen sei kein Problem. Heute? Wohl kaum, wenn er nicht zufällig die richtigen da habe. Man könne ja nicht ständig alle Reifengrößen auf Vorrat lagern. Müsse er auf dem Festland bestellen. Wären mit Glück und Kurieraufschlag morgen Mittag da, wenn’s denn keine ausgefallenen Modelle wären. Bis zum Abend aufgezogen, wenn alles gut ginge. Ne, schneller beim besten Willen nicht. Peter sei da heute ja nicht der Einzige mit diesem Problem.
»Schicken Sie doch mal eben Fotos von den Reifen auf meine Email, dann kann ich sie bestellen«, beendete Werkstattbesitzer Christiansen das Gespräch.
»Vor morgen Abend wird das nichts«, eröffnete Peter seiner Frau, nachdem er das mit den Fotos erledigt hatte. »Und Frau Borg sagt, wir können hier nicht bleiben. Heute Nachmittag kommen neue Gäste.«
Marie blickte Frau Borg halb fragend, halb bittend an. Die zuckte halb bestätigend, halb entschuldigend mit den Schultern und sagte nichts dazu.
»Dann müssen wir ja noch mindestens einen Tag auf der Insel bleiben. Eigentlich zwei, wenn wir mit den Kindern nicht bis tief in die Nacht hinein fahren wollen. Meinst du, wir finden was, Peter?«
»Keine Ahnung. Ich versuchs jetzt mal bei der Touristik.«
Viel Glück hatte er dabei nicht. Zurzeit sei kaum etwas frei gemeldet, das für nur zwei Tage zu mieten wäre, erklärte ihm eine sehr freundliche und wirklich bemühte Dame. Dann auch noch für vier Personen… schwierig, schwierig. Da gebe es nur noch etwas am Noorderstrunwai, wo der Vermieter vielleicht mit sich reden lasse. Koste allerdings 245 Euro die Nacht plus hundert für die Endreinigung. Und für 270 wäre da was im Ortskern. Da komme die Endreinigung aber nur mit 80 Euro obendrauf. Naja, er könne es sich ja noch mal überlegen. Oder er frage mal direkt bei den Hotels nach. Aber am besten nicht zu lange warten, die Betten seien zurzeit immer sehr schnell wieder vom Markt.
»590 oder 620 Euro für zwei Nächte«, rechnete Peter mit bitterer Miene für seine Frau zusammen. »Oder Hotel. Das würde bestimmt nicht viel billiger und wir müssten auch noch ständig Essen gehen. Dann noch die Reifen. Da weiß ich dann ja schon, wo das Weihnachtsgeld in diesem Jahr bleiben wird.«
»Aber die Wohnung müssten Sie dann jetzt doch langsam mal leerräumen«, mischte sich Frau Borg in das Gespräch ein. »Ich schaffe das sonst nicht mehr rechtzeitig mit dem Saubermachen.«
Marie sah für einen kurzen Moment so aus, als werde sie explodieren. Dann fing sie sich und lächelte.
»Aber selbstverständlich, Frau Borg. Wir können ja erst einmal alles ins Auto packen, nicht wahr, Peter? Nur den Parkplatz freimachen, das können wir vorerst wohl nicht«.
So holte Peter die beiden Koffer wieder aus dem Haus, die er schon einmal hin und her getragen hatte. Er verstaute sie auf der Ladefläche des Kombi und lud dann nach und nach den Rest ein. Marie hielt währenddessen die Kinder bei Laune. Julia und Jakob waren inzwischen von der allgemeinen Aufgeregtheit angesteckt und hatten angefangen herumzuquengeln.
Nach wenigen Minuten war alles im Auto untergebracht und Peter, dem Schweißperlen von der Stirn rannen, drückte der Vermieterin mit saurer Miene die Wohnungsschlüssel in die Hand. Dann wandte er sich zum Polizisten, der gerade seine Gespräche mit den Meiers und dem Mercedes-Paar beendet hatte und seinen Notizblock in der Brusttasche verstaute.
»Wie geht es denn jetzt weiter?«
»Tja, wir haben alles aufgenommen, fotografiert und die Spuren gesichert. Ich schicke Ihnen später das Aktenzeichen für Ihre Versicherung. Wir werden versuchen, die Täter ausfindig zu machen. Sie erhalten natürlich Bescheid, wenn wir sie haben. Es tut mir wirklich sehr leid, dass Ihnen das ausgerechnet auf unserer schönen und sonst doch immer sehr friedlichen Insel passieren musste.«
»Kommt sowas hier öfter vor? Ich meine, irgend so ein Verbrechen, wo die Leute dann hier stranden und nicht mehr wegkommen und irgendwie unterkommen müssen?«
»Das mit dem Unterkommen ist auf den Inseln leider immer so ein Problem. Gerade in der Saison. Da können wir Polizisten auch ein Lied von singen, wenn mal externe Kollegen für Ermittlungen über Nacht auf der Insel bleiben müssen. Da gilt es dann zu improvisieren. Können Sie nicht einfach in Ihrer bisherigen Ferienwohnung bleiben, bis Ihr Auto repariert ist?«
»Ich hab doch schon gesagt, dass das nicht geht, wegen der neuen Gäste«, meldete sich Frau Borg in barschem Ton zu Wort. Sie stand, wie Peter erst jetzt registrierte, immer noch hier, anstatt die so dringlich zu putzende Wohnung in Angriff zu nehmen.
»Ja, und ich hab das ja auch schon verstanden, Frau Borg«, sagte Peter zu ihr und fuhr an den Polizisten gewandt fort, »Unter 600 Euro scheint für uns hier aber gerade nichts zu kriegen zu sein. Und so dicke haben wirs leider nicht.«
Der Polizist schaute auf Peter, auf die Frau, auf die Kinder.
»Warten Sie, ich telefoniere mal eben«, sagte er freundlich und entfernte sich für das Telefonat so weit, dass die Familie nicht mitbekam, worum es ging. Nach wenigen Minuten kam er zurück.
»Ich hätte da etwas für Sie, wenn Sie es nicht perfekt aufgeräumt brauchen. Wir haben zwei Häuser entfernt von hier eine Wohnung, die groß genug für Sie vier sein wird. Sie steht leer, weil Montag der Maler kommt. Deswegen ist sie allerdings auch nicht gründlich geputzt. Wenn Sie selber so weit saubermachen, wie Sie es brauchen, und die Betten selber überziehen, können Sie dort bleiben. Zwei Tage oder, wenn Sie wollen, auch bis Sonntag.«
»Und das kostet dann wie viel?«, fragte Peter, der zwischen Freude und Skepsis hin und her gerissen war.
»Sie steht eh leer. Also gar nichts. Betrachten Sie es als Entschuldigung der Insel für das, was Ihnen gerade widerfahren ist, sagt meine Frau. Sie schickt jemanden mit Bettbezügen, Handtüchern und den Schlüsseln. Er kann in zehn Minuten hier sein, wenn Sie die Wohnung nehmen wollen. Was Sie an Gepäck brauchen, können Sie bequem zu Fuß rübertragen. Es ist keine hundert Meter von hier. Wir müssen jetzt leider los. Der nächste Einsatz wartet schon.«
Damit wandte er sich um, winkte seine Kollegin heran und lief zum Streifenwagen. Fassungslos und dankbar schauten Peter und Marie ihm hinterher, als er mit lautem Sirenengeheul wendete und über den Sandweg davonbrauste.
– 2 –
Der Lärm war ohrenbetäubend. Mit seiner ganzen gewaltigen Kraft kämpfte der ausladende Rotor gegen die Erdanziehung an. Dennoch dauerte es einen Moment, bis sich die Reifen des Helikopters vom Untergrund lösten – widerstrebend, einer nach dem anderen, fast so, als würden sie von Klebstoff zurückgehalten. Doch dann schwebte der gewaltige Rumpf plötzlich federleicht empor, und wie vom Wind getragen ließ sich der luxuriös ausgestattete Transport-Hubschrauber in einer taumelnden Kurve über das Heck des Schiffes hinauswehen.
Thomas Matsen winkte seiner Frau einen fröhlichen Gruß hinterher. Bequem in ihren breiten Sessel zurückgelehnt, winkte Mary durch die großflächigen Seitenscheiben des Helikopters zurück. Dann drehte das Fluggerät in Richtung Cuxhaven ab. Mary verschwand aus Matsens Blick. Er würde an diesem Wochenende auf ihre Gesellschaft verzichten müssen. Zusammen mit den letzten zehn der insgesamt fast fünfzig Journalisten, die zur Pressekonferenz auf die „Princess of Barunia“ gekommen waren, flog sie nach Hamburg zurück. Die Botschaft von dem, was hier heute auf der Luxusyacht des Emirats unterzeichnet worden war, hatten die meisten Journalisten zwar noch von Bord aus in die Welt hinaus gesendet. Aber Mary würde in den nächsten Tagen dafür sorgen, dass diese Botschaft auch im Bewusstsein der Welt blieb. Ein Meilenstein, der, wie sie hofften, eine Lawine an weiteren Mega-Projekten nach sich ziehen würde.
Es war außerdem ihre Chance, die letzten Reste der Diffamierungs-Kampagne abzuwaschen, mit der der Ecofare-Konzern in den vergangenen Jahren überzogen worden war. Sie würden alles tun, um diese Chance zu nutzen.
Der Prinz nahm die Ohrenschützer vom Kopf und ließ sie in die Hände eines der unzähligen Bediensteten fallen, die den ganzen Tag hindurch fast unsichtbar um ihn herum wehten. Sie waren kaum mehr zu spüren als ein Lufthauch. Und mehr als einen solchen schien er sie auch nicht wahrzunehmen.
»Sie lieben Ihre Frau«, stellte Prinz Abdul al Rahman in seinem perfekten, deutlich von Oxford geprägten Englisch fest und lächelte Matsen dabei gewinnend an. Es war eine Feststellung, in der eine leichte Überraschung mitzuschwingen schien, hinter der aber nicht der Hauch eines Fragezeichens zu spüren war.
»Ja, das tue ich«, bestätigte der Manager im typischen Akzent der Metropole New York, deren Sprache er in jahrelangem akribischem Training vollständig verinnerlicht hatte.
Er beherrschte den Tonfall und den Habitus der Wall-Street-Manager im Schlaf, ohne sich von ihnen innerlich vereinnahmen zu lassen. Der nur in dieser Großstadt beheimatete Akzent betonte, ergänzt um ein wiederum nur an der Börse gebräuchliches Vokabular, eine Gewissheit für … was auch immer. Diese Gewissheit im sprachlichen Ausdruck ließ keinerlei Zweifel zu, weder an der Klarheit und Vorhersagbarkeit wirtschaftlicher oder geopolitischer Entwicklungen noch an der alleinigen Weisheit des Sprechenden.
»Man sieht es mir offenkundig an«, fügte Matsen in verbindlicherem, britischem Tonfall mit einem Lächeln hinzu.
Die Männer blickten dem Hubschrauber hinterher, bis er am Horizont verschwunden war, dort, wo das dunkle Grau des Meeres in das kaum hellere Grau des Himmels überging. Der Regen hatte eine Pause eingelegt, die Luft war frisch und würzig. Den Kerosingeruch des Hubschraubers hatte es inzwischen ebenso hinfort getragen wie das grausame Gebrüll, das sein 1.500 PS starker Motor von sich gab. Es roch nur noch nach Meer, nach Salz, nach Algen.
Matsen genoss die Seeluft, die das Hubschrauberdeck der Yacht umwehte, in vollen Zügen.
»Riechen Sie es? Das Meer?«, wandte er sich an den Prinzen. »Was für ein herrlicher Duft.«
Der Angesprochene nickte in vollkommener Zustimmung; auch er war ein Freund des Meeres. Fast gleichzeitig glitten die Blicke der Männer zu den Schornsteinen hinüber. Obwohl die 130-Meter-Yacht mit ihrem gewaltigen Antrieb nun in der äußeren Elbmündung kräftig Fahrt aufgenommen hatte, kamen lediglich feine weiße Wölkchen aus ihnen heraus. Absolut geruchlos.
»Was für ein Erfindung«, schwärmte der Prinz. »Wie gut, dass wir uns damals in New York getroffen haben.«
„Damals“, das war vor vier Jahren gewesen. Eine Konferenz der Vereinten Nationen zur Zukunft der Energiewirtschaft. Das war noch zu Zeiten von Präsident Obama gewesen. Abdul al Rahman war im Auftrag seines Vaters, des Herrschers von Barunia, mit einer Delegation der arabischen Ölproduzenten angereist. Thomas Matsen hatte sich mit seinem Ecofare-Konzern zum Sprecher der im Vergleich winzig kleinen Liga für erneuerbare Energien gemacht. Die Fronten prallten hart aufeinander, allerdings waren es vor allem die großen Mineralölkonzerne, die die Messer wetzten, als Matsen seine Rede hielt. Die Araber blieben hingegen sehr ruhig, hörten zu, machten sich viele Notizen.
Abends, an der Bar des Mandarin Oriental Hotels, trafen al Rahman und Matsen dann zufällig wieder aufeinander. Die arabischen OPEC-Mitglieder hatten im Park Hyatt und St. Regis eingecheckt, der Prinz hatte sich, wie er später offenbarte, ganz bewusst für eine Unterkunft abseits von ihnen entschieden.
An diesem Abend hatte Mary ihren seit Monaten ersten New-York-Aufenthalt dazu genutzt, ihre Eltern zu besuchen. Sie wollte sie im persönlichen Gespräch schonend darauf vorbereiten, dass sie bald heiraten würde. Ihren Chef Thomas Matsen. Daher musste Matsen an diesem Abend ohne sie auskommen, was in der jüngeren Vergangenheit eher selten vorgekommen war. Er wollte eine Kleinigkeit an der Bar essen und einen Schluck trinken, bevor er sich in seiner Suite wieder an den Schreibtisch setzte.
Gerade hatte er den Barmann mit einem freundlich, aber unnachgiebig geforderten »Das werden Sie ja wohl irgendwo in der Stadt auftreiben können« losgeschickt, ihm eine große Portion Lachs- und Thunfisch-Sashimi und ein Dutzend Röllchen Nigiri-Sushi, ebenfalls mit Lachs und Thunfisch, zu besorgen. In diesem Moment setzte sich al Rahman neben ihn.
»Darf ich?«, fragte dieser pro forma, hatte sich allerdings bereits auf dem Barhocker neben Matsen niedergelassen, bevor dieser eine Chance hatte zu antworten.
»Kennen wir uns?«, fragte Matsen kühl. Der Mann war wohl um die Fünfzig und trug einen maßgeschneiderten grauen Business-Anzug ohne Krawatte. Ein dichter, schwarzer, nicht sehr langer, dabei überaus gepflegter Bart umhüllte das Gesicht und ging nahtlos in eine lockige Kurzhaarfrisur über. Die dunklen, fröhlich blitzenden Augen wurden links und rechts von Lachfältchen begrenzt. Diese Augen waren es vor allem, was Matsen daran gehindert hatte, den ungebetenen Gast rüde davonzuscheuchen. Sie gefielen ihm und kamen ihm auch irgendwie bekannt vor.
»Die Sitzung vorhin. Bei der UN. Ich bin Mitglied der Erdölproduzenten, und war natürlich gekleidet wie bei uns üblich. Es war hoch interessant, was Sie dort über Wasserstofftechnik gesagt haben, Herr Matsen. Und über Ihre Ansätze bei Wind- und Solarenergie. Die ungeheuren Fortschritte, die Sie bei der Effizienz Ihrer Anlagen gemacht haben. Können wir darüber reden?«
»Schon möglich«, hielt sich der Ecofare-Chef bedeckt. Freundlichkeit oder gar positives Interesse hatte er aus Richtung der Erdölbranche bislang noch nicht oft erlebt. Deren Abneigung gegen ihn war ihm durchaus verständlich. Schließlich hatte er aus seinem Ziel, die Ölmagnaten arbeits- und brotlos zu machen, nie einen Hehl gemacht. Im Gegenteil. Umso unverständlicher jetzt die Freundlichkeit. Matsen ließ seinen Stuhlnachbarn an diesen Gedanken teilhaben.
»Mit einem alten Kamel können Sie kein Rennen gewinnen. Selbst wenn es mal der Champion war. Der kluge Mann investiert in das Fohlen, auch wenn seine Zeit noch nicht gekommen ist.«
Matsen nickte: »Öl ist für Sie der alternde Champion, Wasserstoff das vielversprechende Fohlen?«
»Genau so ist es«, bestätigte al Rahman. »Oder es könnte zumindest so sein, wenn wir uns da einig werden.«
»Und wer ist ´wir`?«
»´Wir`, das ist das Emirat Barunia. ´Wir`, das sind zigtausende Quadratkilometer wolkenloser Sonnenschein und endlose Kilometer windumtoste Küsten. ´Wir`, das sind Öl-Dollar in bald dreistelliger Milliarden-Höhe, mit denen wir kaum wissen, wohin. Die möchte ich gerne investieren für eine Zeit, in der das Öl aufgebraucht ist oder in der es keiner mehr haben will.«
Ein Kellner mit weißem Hemd und schwarzer Weste kam mit einer großen, von einer ovalen Silberkuppel bedeckten Platte.
»Darf ich?«, erkundigte er sich höflich.
Auf Matsens Nicken hin stellte er die Platte auf den Bartresen und lüftete die Kuppel. Die Portion war gewaltig und bot neben frisch duftendem Sushi und Sashimi eine kleine, aber feine Auswahl an Sojasaucen sowie den „Wasabi“ genannten, grün gefärbten japanischen Meerrettich und „Gari“, jenen in hauchdünne Scheiben geschnittenen, süß-sauer eingelegten Ingwer, der bei diesem Gericht niemals fehlen durfte. Links und rechts der Platte drapierte der Barmann Teller, Schälchen, Besteck und Stäbchen. Man schien davon auszugehen, dass die beiden Männer gemeinsam essen.
»Mögen Sie japanisches Essen?«, fragte Matsen. Und als sein Stuhlnachbar nickte, lud er ihn mit einer freundlichen Geste ein zuzugreifen.
Matsen bestellte sich ein Wasser und einen weißen Sancerre. Der Prinz tat es ihm gleich. Den überraschten Blick des Managers quittierte er umgehend mit einer Erklärung.
»Es steht geschrieben: Wenn du auf Reisen bist, passe dich den Landesgewohnheiten an.«
Als Matsen später noch ein zweites Glas orderte und seinen Gesprächspartner fragend anschaute, lachte dieser: »Aber übertreibe es mit den Landesgewohnheiten nicht, heißt es weiter.«
Es war ein langer Abend geworden, in dessen Verlauf erste Pläne geschmiedet und sogar schon Beschlüsse gefasst worden waren und während dessen der Prinz auch irgendwann sein Handy zückte und ein Bild seiner Yacht zeigte.
»Können Sie die auf Wasserstoffantrieb umstellen?«, fragte er.
Matsen war überrascht. »Grundsätzlich wohl schon«, sagte er vorsichtig. »Aber ich fürchte, den einzubauen wird nicht viel günstiger werden als ein komplett neues Schiff.«
»Macht nichts«, winkte der Ölmagnat ab. »Der Diesel stinkt mir gewaltig. Und wenn das, wie bei Ihren Fähren, auch anders geht, dann ist mir jede Summe recht.«
Und so standen sie nun, vier Jahre später, hier an Deck der in Hamburg auf Wasserstoff umgerüsteten Luxusyacht, die heute mit neuem Antrieb ihre Jungfernfahrt erlebte. Dies war der Grund gewesen, die Weltpresse gerade hierher, auf das Schiff, einzuladen, und mit ihr die Elbe hinunter zur Nordsee zu fahren. Der eigentliche Anlass aber war weit größer. Er sicherte ihnen die Titelseiten der Zeitungen überall auf dem Globus – und für eine Weile zudem eine Top-Position in den Internet-Suchmaschinen: Ecofare würde in der Steinwüste von Barunia für einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag die weltweit größte Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien aufbauen. Sie könnte schon in wenigen Jahren die Erdölproduktion des Emirats übersteigen und einen gewaltigen Meilenstein beim Kampf gegen den Klimawandel setzen. Die mit Wasserstoff angetriebene Luxusyacht machte eine praktische Seite dieses Vorhabens deutlich.
Zu Matsens Erstaunen hatte es auch auf Letzteres ausschließlich positive Resonanzen der Journalisten gegeben. Er selbst kannte den Energieaufwand, der in den Umbau des Schiffes geflossen war, und hielt es für vollkommen unangemessen, so viel CO2 für das Freizeitvergnügen eines Einzelnen auszustoßen. Das aber behielt er, wie viele andere seiner Überzeugungen, für sich.
»Hunger?«, fragte der Prinz, als sich ihre Blicke von den Schornsteinen gelöst hatten.
»Ja, riesig.«,
»Japanisch?«
»Sehr gerne« lächelte Matsen. »Sie haben es sich offenkundig gemerkt?«
»Natürlich habe ich das. Aber wir haben auch eine Akte über Sie«, lachte der Prinz und blätterte pantomimisch in einem imaginären Aktenordner. »Ah, hier haben wir es«, sein Finger glitt eine vermeintliche Zeile entlang. »Matsen liebt japanisches Essen, steht hier, aber nur, wenn es gut ist. Keine Sorge, mein Freund; es wird gut sein.«
Der Prinz führte seinen Gast durch breite Gänge und üppig ausgestattete Salons in einen Bereich des Schiffes, der einem modernen japanischen Restaurant nachempfunden war. Ein stählerner, als Kreis aufgebauter Bar-Tresen bildete das Zentrum des Raumes, der mit über drei Meter Deckenhöhe und riesigen Fenstern absolut nicht nach Schiff aussah. Zwei Köche, nach Matsens Vermutung japanischer Herkunft, standen im von Barhockern umrahmten Tresen an einem Küchenblock. Außer ihnen und den unscheinbaren Bediensteten, die den Prinzen auch hier umwehten, war niemand anwesend.
Die beiden Ankömmlinge ließen sich auf Hockern nieder, die einen Blick an den Köchen vorbei durch die Fenster aufs Meer hinaus boten. Dessen heranrollende Wellen brachten das riesige Schiff nur unwesentlich ins Schwanken.
Die Köche servierten ein Sashimi von der Bernsteinmakrele. „Hamachi“. Die Männer füllten ihre Schälchen mit Sojasauce, rührten ein wenig Wasabi hinein – beide ungefähr die gleiche Menge, wie sie lachend feststellten – und stippten die weißlich-rosafarbenen Fischfilets ein. Das Fleisch war von fester, aber zarter Struktur, der Geschmack fein und facettenreich. Matsen und al Rahman gerieten ins Schwärmen.
Es folgten Tintenfisch-Scheibchen, die dem Kauenden kräftigen Widerstand boten, und ein Filet vom Großaugen-Thunfisch, das buchstäblich auf der Zunge zerging. Ein Seeigel zum Auslöffeln und ein bunt gemischter Salat bildeten den Abschluss der kalten Vorspeisen. Als Hauptmahlzeit brieten die Köche Garnelen in Tempura-Teig, servierten Lachs-Teriyaki mit gegrilltem Gemüse und bereiteten schließlich ein unvergleichliches Entrecote vom Kobe-Rind zu.
Das Gespräch bei Tisch drehte sich um Wasserstoff und erneuerbare Energien. Vor allem darum, wie sich die Umstellung des Verkehrs auf Elektrizität und Wasserstoff möglichst schnell vorantreiben ließe.
»Am schwierigsten zu lösen ist der Flugverkehr«, bedauerte Matsen. »Wir kommen mit der Entwicklung von synthetischem Kerosin zwar voran, aber bis zur Marktreife dauert es sicherlich noch fünf Jahre. Dafür stehen wir bei der Feststoffbatterie kurz vor der Serienproduktion. Wir haben sie zum wiederaufladbaren Akku weiterentwickelt. Es fehlt uns nur noch eine Patentabtretung, dann können wir damit in Serie gehen.«
»Feststoffbatterien?« Das machte den Prinzen neugierig.
»Sie sind leicht, sparen Platz, kommen ohne Lithium und Kobalt aus, und das Aufladen mit Strom geht fast so schnell wie das gewohnte Tanken von Diesel und Benzin. Bisher waren die Batterien nach ein paarmal Aufladen hinüber. Unsere Entwicklung hält nun aber schon mehr als eintausend Ladevorgänge ohne wesentliche Einbußen aus und bringt einen PKW mit wenigen Minuten Ladezeit deutlich über 500 Kilometer weit. Das ist die Revolution im Verkehr und vielleicht auch im Zwischenspeichern von erneuerbaren Energien.«
»Aber es gibt da noch ein Problem, nehme ich an?«
»Nicht wirklich. Oder, naja«, räumte Matsen ein, »vielleicht doch. Das Basispatent gehört den Thienschen Werken in Lübeck. Wir haben nur eine befristete Lizenz dafür. Wir wollen das gesamte Werk kaufen, vor allem wegen dieses Patents. Unser Angebot ist großzügig, und die Verträge sind schon geschrieben. Nur der Haupteigner will noch nicht so recht. Seine Kinder sind heute bei ihm, um ihn zu überzeugen.«
»Kenne ich«, grinste der Prinz. »Mein Vater stellt sich bei Neuem auch immer quer. Aber am Ende habe ich ihn doch jedes Mal überzeugt. Wie jetzt mit dem Wasserstoff-Projekt. Wollen wir darauf mit einem Glas Sake anstoßen?«
Matsen vermied es in der Regel, tagsüber Alkohol zu trinken, und auch abends war er damit eher zurückhaltend. Aber bei diesem besonderen Anlass und angesichts der Tatsache, dass sein Gastgeber sich hier gerade »den Landessitten anpassen« wollte, stimmte er zu. Außerdem liebte er Sake. Guten Sake. Und dass er auf diesem Schiff einen Guten bekommen würde, stand für ihn außer Frage.
Und tatsächlich: Serviert wurde ein perfekt gekühlter Junmai Daiginjo, für dessen Herstellung die Reiskörner zu weit über 50 Prozent herunter poliert worden waren. Edel, herb und mit einer ungeheuren Bandbreite an milden Aromen.
»Kanpai! Auf die Wasserstoff-Zukunft«, prostete Abdul al Rahman seinem Gast zu.
»Kanpai«, wiederholte Matsen das japanische »Zum Wohl«.
»Meine Freunde nennen mich übrigens Abi, mein Freund. Natürlich nicht im Emirat; da bin ich Eure Exzellenz. Aber die von der Uni in Oxford und so.«
»Meine Freunde nennen mich Tom, mein Freund«, gab Thomas Matsen zurück. »Für die ganz alten von der Uni bin ich Tommy.«
»Ah, okay, Tommy. Es freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Und ich freue mich darauf, diese sagenumwobene Insel kennenzulernen, die du autofrei machen willst.«
– 3 –
Der Himmel war grau in grau, die Landschaft triefte vor Nässe. Eine kräftige Brise trieb den Nieselregen von Nordwesten heran. Sie wehte die feinen Wasserperlen in Schwaden über die Insel hinweg. Der feuchte Nebel durchdrang selbst feinste Ritzen, sei es in den Häusern oder in der Kleidung.
Auf Mauern, Scheiben, Mensch und Tier verdichteten sich die Tropfen zu Rinnsalen, liefen an ihnen herab, bildeten überall seichte Pfützen.
Bodo von Thien machte das Wetter nichts aus. Ganz im Gegenteil: Er mochte es. Es hatte für ihn etwas Erfrischendes, Natürliches. Es weckte die Lebensgeister, es erdete ihn. Zu seinem Bedauern milderte es aber auch die aufgebrachte Stimmung, in der er war. Zumindest ein wenig. Die würde er später künstlich wieder aufbauen müssen.
Was der schwergewichtige Unternehmer im Unruhestand an solch einem Wetter ebenfalls genoss: Es bot ihm die Gelegenheit zur Selbstdarstellung. Er, der dem Wetter unbeeindruckt trotzte, während andere fluchend oder gar jammernd Schutz davor suchten. Es war ein protzendes, den Selbstwert emporhebendes Gefühl, und wann immer er sich in seinem heldenhaften Auftreten von anderen wahrgenommen glaubte, schwoll es bis zur Euphorie an.
»Schaut her, wir Insulaner sind beinhart«, strahlte es dann aus ihm heraus. »Das bisschen Wetter kann uns nicht schrecken.«
Denn das war er jetzt: Insulaner! Er war ganz nach Amrum gezogen, bewohnte nun dauerhaft sein Haus in Süddorf, das er in den Jahrzehnten zuvor immer nur für kurze Ferienzeiten hatte nutzen können. Er gehörte jetzt dazu, auch wenn die gebürtigen Amrumer das noch nicht so recht wahrhaben wollten. Er gehörte dazu, und er würde sich einbringen. Er würde die Insel prägen, er würde sie so gestalten, wie er sie haben wollte. So wie er das zeitlebens mit seinem Unternehmen getan hatte und in dem Markt, den es lange Zeit beherrscht hatte.
Und genau dazu setzte er auch jetzt wieder an, als er mit seinem Fahrrad aus dem Sösarper Strunwai nach links auf die Landstraße in Richtung Nebel abbog. Bis vor vier Wochen hatte er für die Strecke ins Nachbardorf wie jeder andere den schmalen Fuß- und Radweg am Rande der Landstraße benutzt oder war außen herum über Stianoodswai und Uasterstigh gefahren. Das war nun vorbei. Jetzt fuhr er auf der Landstraße, und nicht etwa am Rand, sondern genau in der Mitte des rechten Fahrstreifens. Denn seit er mit seinem Verein „Amrum autofrei e.V.“ die ersten öffentlichen Auftritte hingelegt hatte, ließ Bodo von Thien keine Gelegenheit mehr aus, den Autoverkehr auf der Insel zu stören. Solche Gelegenheiten boten sich recht häufig, sozusagen jedes Mal, wenn er das Fahrrad aus seiner seit langem autofreien Doppelgarage holte und sich maximal behindernd auf den Weg nach Nebel oder Wittdün machte.
Der mächtige Körper auf dem vergleichsweise zierlichen Fahrrad mochte aufgrund der so gegensätzlichen Proportionen ein wenig komisch wirken. Gerade jetzt, wo er komplett in eine dunkelgraue Regenkombi gehüllt war, nass glänzend wie ein Hinkelstein auf Reisen. Gleichzeitig war dieser massige Körper aber so Respekt einflößend, dass trotz der provozierenden Aktionen noch niemand versucht hatte, sich in direkter Konfrontation mit ihm anzulegen. Hupend vorbeisausen war die bislang aggressivste Reaktion gewesen.
Bodo von Thien war am Ende des Sösarper Strunwai angekommen. Der Bus, dem er beim Einbiegen auf die Landstraße eben noch die Vorfahrt hatte gewähren müssen, hatte rechts an der Haltestelle gestoppt. Zwei Männer und zwei Frauen mittleren Alters waren ausgestiegen, hatten sich mit lautem »Iiieeh« ihre Kapuzen über die Köpfe gezogen und waren davongeeilt. Den riesigen Mann auf dem Fahrrad, der hier knallhart dem Wetter trotzte, hatten sie dabei gar nicht wahrgenommen. Trotz dieser enttäuschenden Missachtung entlockte die Szene ihm ein befriedigtes Lächeln: Er war an dem Bus vorbei, bevor dieser wieder anfuhr. Mit ein wenig Glück würde ihn dieser bis Nebel nicht überholen können, sondern mit gemächlichen zehn Stundenkilometern hinter ihm her zuckeln. Und alle Autos, die danach kamen, ebenfalls.
Das Glück des Unruheständlers währte jedoch nur kurz. Es gab keinen Gegenverkehr; der doppelt lange Bus setzte mühelos zum Überholen an, zog mit gewaltigem Sog an ihm vorbei. Als er wieder nach rechts einscherte, wurde der böig heranwirbelnde Nieselregen mit dem hochgeschleuderten Spritzwasser vermischt und traf von Thien als schmutzignasser Schlag mit einer Härte, die ihm für einen Moment den Atem raubte.
»Saukerl«, brüllte der Radler, und nachdem er das schwankende Fahrrad wieder so weit stabilisiert hatte, dass er sich eine Hand vom Lenker zu lösen traute, schüttelte er dem Busfahrer eine Faust hinterher. Doch schon raste laut hupend ein Auto an ihm vorbei, dem Bus hinterher, und eine weitere Bö zwang ihn, auch die zweite Hand wieder auf den Lenker zu senken. »Natürlich NF«, brummelte von Thien mit Blick auf das Nummernschild. Urlauber nahmen seine Verkehrsprovokationen gelassener hin als die Einheimischen.
Doch nun kam ihm ein Bus entgegen, und die linke Fahrbahn war für Überholende blockiert. Danach folgten in kurzen Abständen immer wieder Autos. Stück für Stück sammelte der Radfahrer seine Follower ein. Sie alle mussten hinter ihm bleiben, bis er schließlich geruhte, vor der Mühle nach rechts abzubiegen. »Sieben Stück«, stellte er mit einem befriedigten Lächeln beim Blick zurück fest. Ein Rekord war das zwar nicht, an guten Tagen hatte er auch schon mal bis zu 15 Autos und drei LKW einsammeln können. »Aber Kleinvieh macht auch Mist«, grinste er.
In der kleinen Stichstraße, die hinunter zum Uasterstigh führte, konnte der Radfahrer zu seinem Bedauern niemandem mehr im Weg sein, und auch auf dem letzten Stück bis zu seinem Ziel im Ualaanj begegnete er weder einem Auto noch einem anderen Rad. Nicht einmal Fußgänger waren hier zurzeit unterwegs.
Bei dem weiß gestrichenen Reetdachhaus, das sein Ziel war, fuhr er direkt in den Vorgarten und ließ sein Fahrrad achtlos auf das kleine Rasenstück neben dem Kiesweg zum Eingang fallen. Diese Geste sollte die Wut zum Ausdruck bringen, die auf dem Weg hierher zwar ein wenig verpufft war, die er nun aber wieder aufleben lassen wollte. Kräftigen Schrittes ging er auf die blau gestrichene Tür am Ende des Kieswegs zu. Mit seiner mächtigen Faust klopfte von Thien mehrmals so kräftig gegen die mit zwei großen Sichtfenstern durchsetzte Tür in der Mitte des Windfangs, dass deren Scheiben klirrten. Nichts tat sich. Der Unternehmer setzte mit fünf noch kräftigeren Schlägen nach, ohne sich um das, wie es schien, kurz vor dem Zerbersten stehende Scheibenglas zu scheren. Wieder gab es keine Reaktion von drinnen. Er spähte an den geklöppelten weißen Gardinen mit ihren Blumenmotiven vorbei ins Innere. Es war keine Bewegung zu erkennen. Er drückte den Türgriff nach unten und zog; es war nicht abgeschlossen. Geräuschlos schwang die schwere Tür in gut geölten Angeln nach außen auf.
Der Windfang war ein vielleicht anderthalb Meter tiefer, nach links und rechts um etwa die gleiche Länge ausgedehnter Vorbau vor der eigentlichen Eingangstür. Rundum waren Fenster im selben Format eingelassen wie in der Tür, durch die er den Vorbau soeben betreten hatte. Und ebenso wie dort waren die Scheiben durch die unten gerafften geklöppelten Gardinen nur halb verdeckt. Links an der Hauswand gegenüber der Windfangtür wölbte sich ein gewaltiger Berg von Jacken und Mänteln an einer ausladend breiten Garderobe. Der Eindringling schenkte dem ebenso wenig Beachtung wie dem riesigen, prall gefüllten Schuhregal, das fast die gesamte Breite der rechten Wand einnahm. Vor diesem stand ein Stuhl, und griffbereit daneben lagen ein Schuhlöffel und eine Auswahl von Bürsten auf dem aus roten Ziegelsteinen gefertigten Boden. Sicherlich wäre von Thien von den Jacken und mehr noch von den Schuhen irritiert gewesen, wenn er denn hingeschaut und sie wahrgenommen hätte. Doch sein Blick galt nur der eigentlichen Eingangstür ins Haus, die direkt geradeaus vor ihm lag. Sie sah fast genauso aus wie die, durch die er gerade den Windfang betreten hatte.
Bodo von Thien war zum ersten Mal hier. Er hatte seinen Vereins- und Vorstandskollegen Johann Steffens noch nie besucht. Sie waren nicht gerade Freunde. Das mochte der Grund sein, warum dieses ungebetene Eindringen in das Haus seines Mitstreiters nun einen ungewohnten Anflug von Unsicherheit in ihm aufkeimen ließ. Mehr als ein kurzes Zögern verursachte diese Unsicherheit allerdings nicht. Seine Schläge gegen die Haustür fielen genauso hart aus wie beim Windfang und ließen deren Scheiben ebenso vibrieren. Doch diesmal gab es eine Reaktion: Ein genervt-aggressives »Ey« war aus dem Haus zu hören, kaum dass er den letzten Schlag gegen die Tür geführt hatte. Eine Frauenstimme, wie von Thien überrascht registrierte. Soweit er wusste, wohnte Johann Steffens allein. Aber er hatte eine Tochter auf dem Festland. Vielleicht war die ja zu Besuch.
Der ungebetene Besucher hörte Geräusche im Haus, Augenblicke später wurde die Tür geöffnet. Das war definitiv nicht Johann Steffens und auch definitiv nicht dessen 42 Jahre alte Tochter. Vor ihm stand eine Frau, barfuß und in dunkelblauem Bademantel, vielleicht Anfang dreißig, die, obwohl es bereits 13 Uhr war, geradewegs aus dem Bett zu kommen schien. Ihre dunklen, fast schwarzen Augen waren schlaftrunken, die langen, schwarzen Haare zerzaust, auf ihrer Wange hatte ein Kissen seinen Abdruck hinterlassen. Trotzdem verschlug es Bodo von Thien für einen Moment den Atem, so schön war sie.
»Was gibts denn?«, fragte sie mit verschlafener, aber durchaus freundlicher Stimme und schaffte es trotz offenkundigen Bemühens dabei nicht ganz, ein aufsteigendes Gähnen zu unterdrücken.
»Äh, Steffens«, stammelte er irritiert.
Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, was der alte Griesgram mit dieser jungen Frau zu schaffen haben könnte. Einen Augenblick später hatte er sich aber schon wieder im Griff. Wer war er denn, sich durch so eine ablenken zu lassen! »Johann Steffens. Ist er da?« Ohne eine Antwort abzuwarten setzte er an, sich an der Frau vorbeizuschieben. Doch es blieb beim Versuch.
»Stopp!«, sagte sie scharf und hielt ihm gebieterisch die offene Handfläche entgegen. »Sie bleiben, wo Sie sind!«
Sie wurde nicht laut, aber der Ton und die Geste duldeten keinen Widerspruch, nicht einmal vom herrischen Herrn von Thien. Seine Vorwärtsbewegung fror nicht nur sofort ein, er machte sogar einen erschrocken wirkenden Schritt zurück.
»So ists brav«, lobte die Frau, die jetzt hellwach und trotz seiner imposanten Statur ganz offenkundig bereit und vielleicht sogar fähig war, ihm den Zugang notfalls mit Gewalt zu verwehren. Nichts an ihr deutete auf eine Unsicherheit hin. »Wenn Sie zu Johann Steffens wollen, dann sind Sie hier falsch. Der wohnt nebenan.«
Dabei deutete sie mit einer vagen Armbewegung nach rechts.
Hatte er sich tatsächlich im Haus geirrt? So musste es wohl sein. Die Frau, von der nun jegliche Freundlichkeit abgefallen war, machte nicht den Eindruck, als würde sie scherzen. Mit einer gemurmelten Entschuldigung trat er den Rückzug an, schloss die Windfangtür von außen und blickte auf das Namensschild, das daran angebracht war. Bei seinem Ansturm vorhin hatte er es überhaupt nicht beachtet. »Mara Olufsen« stand in gravierten Druckbuchstaben deutlich lesbar darauf. Er verfluchte sich für diesen peinlichen Fehler, packte sein Fahrrad und schob es vom Grundstück hinunter zum Nebenhaus.
»Okay, zumindest verständlich«, dachte er nun. Das Haus sah oberflächlich betrachtet fast genauso aus wie das der Nachbarin. Ein einziges Mal war er hier zusammen mit Steffens vorbeigekommen, als sie auf dem Rückweg von einer Sitzung in Steenodde waren. Steffens hatte ihn nicht hineingebeten. Sie hatten sich draußen auf dem Ualaanj verabschiedet.
Der deutlichste Unterschied zum Nachbarhaus war der Weg zum Eingang, der hier mit Betonplatten, nebenan mit Kies bedeckt war. Dafür wurde er in diesem Vorgarten von einer ganzen Armee von Gartenzwergen umrahmt. Jeder Einzelne von ihnen war mit einem Werkzeug bewaffnet und ging damit irgendeiner Tätigkeit nach.
Von Thien schenkte ihnen keine weitere Beachtung. Er schob sein Fahrrad Richtung Windfang, stellte es diesmal aber ordentlich auf dem Weg ab. Die Lust auf wütende Gesten war ihm gerade irgendwie abhanden gekommen. Die Begegnung mit der jungen Frau hatte ihn sogar ein wenig kleinlaut werden lassen.
Bevor er die Klinke der Windfangtür hinunterdrückte, deren gleichfalls geklöppelte Gardinen anders als nebenan maritime Muster zeigten, schaute er bewusst konzentriert auf das über einem Briefschlitz angeschraubte messingfarbene Namensschild. »Johann Steffens« war da in Schreibschrift eingraviert.
»Na, warum denn nicht gleich so«, knurrte von Thien.
Auch hier war die Tür nicht abgeschlossen, auch hier schwang sie lautlos in gut geölten Angeln auf.
Nebenan hatte er auf nichts geachtet, zumindest nicht bewusst. Doch sein Unterbewusstsein hatte genug registriert, um ihn sofort einige Unterschiede wahrnehmen zu lassen. Diesmal schaute er genauer hin, sah links eine schmale Garderobe mit lediglich einer Windjacke, einer Regenjacke und einer Regenhose daran, rechts ein flaches, offenes Schuhregal mit einem Paar Gummistiefel, einem Paar Wanderstiefel, einem Paar Halbschuhe und Turnschuhen. Steffens war ihm in allen diesen wenigen Kleidungsstücken bereits früher schon mal begegnet. War nebenan nicht alles rappelvoll gewesen? Ja, irgendwie schon. Er hätte es an vielen Details merken können, dass Steffens dort nicht wohnte. Aber er hatte sich gar nicht dafür interessiert, war viel zu sehr in Rage gewesen.
Sollte er diese Aufregung und Wut jetzt wieder heraufbeschwören? Von Thien entschied sich dagegen. Irgendwie hatte die Szene nebenan ihm die Luft rausgelassen, und das nicht nur, weil er sich geirrt hatte. Fast hätte er sich an dieser jungen Frau vorbei in ihr Haus gedrängt. Ein Überfall quasi. Hausfriedensbruch! Das ließ sogar einen Mann wie ihn nicht ganz unberührt. Zudem hatte sich ihre Schönheit auf merkwürdige Weise fast körperlich in seine Knochen gegraben. Nun tauchte bei dieser Feststellung sogar noch ein zaghaftes Lächeln auf seinem Gesicht auf. Er schüttelte es ab und konzentrierte seine Gedanken auf Steffens. Dann klopfte er an die Haustür. Verhalten, fast schon zaghaft. Es tat sich nichts. Er klopfte kräftiger.
»Moment«, rief es von drinnen. »Komme gleich.«
Dann war wieder Stille. Lange Stille. Von Thien wurde ungeduldig. Das war gut, stellte er fest, denn es half ihm, die Wut wieder aufzubauen. Er klopfte erneut. Kräftiger.
»Ja doch! Moment noch!« Es war eindeutig Johanns gereizte Stimme, die er da hörte. Dann wurde es wieder still.
Von Thien entschloss sich zu warten, half es doch seiner Wut beim Hochschaukeln. Zwei weitere Minuten hatte sie dafür Zeit, dann erst hörte er Schritte im Haus. Die Tür wurde geöffnet.
»Ach du bist das«, sagte der Hausherr überrascht und blickte ihn durch die dicken Gläser seiner unmodischen, breitrandigen Brille gelangweilt an. Er versuchte nicht einmal zu verbergen, wie wenig ihn der Besuch freute.
Johann Steffens war ein hochgewachsener hagerer Mann mit einem schmalen, verhärmten Gesicht, in das sein ungeliebtes Lehrerdasein tiefe Furchen gegraben hatte. Sie zogen sich wie Canyons an den blassen, nach innen gewölbten Wangen und der beeindruckend kräftigen Nase vorbei. Gekrönt wurde der langgezogene Kopf von immer noch vollem, strähnigem, schmutziggrauem Haar, das er nach hinten gestriegelt hatte und nach Meinung seines ebenso ergrauten, aber stoppelhaarigen Vereinskollegen deutlich zu lang trug. Über die hellblaue Jeans und das rot-blau karierte Hemd hatte er eine altmodische Schürze gebunden, weiß mit breiten rosa Streifen, die mit zahlreichen roten Flecken gesprenkelt war. Er war offenkundig gerade in der Küche beschäftigt gewesen.
»Komm rein, aber lass Schuhe und Jacke draußen«, befahl Steffens knapp und bar jeder Freundlichkeit. Ohne eine Reaktion abzuwarten, drehte er sich auf dem Absatz um, ließ den Besucher vor der geöffneten Eingangstür stehen und verschwand im Inneren des Hauses aus dem Blickfeld.
Von Thien war es weder gewohnt, so angesprochen, noch so stehen gelassen zu werden. Jetzt brauchte es gar keine künstliche Anstrengung mehr, um die Wut zu schüren. Es geschah von ganz allein. Trotzdem entschied er sich nach kurzem Zögern, Jacke und Schuhe tatsächlich im Windfang zu lassen, anstatt dem pensionierten Lehrer für Biologie und Geschichte sofort hinterherzupreschen. Er ließ sich nun sogar extra viel Zeit dabei, die Jacke an die Garderobe zu hängen und seine schweren Stiefel auszuziehen. Dann entledigte er sich auch der Regenhose, ruckelte die hellbraune Cordhose, die er darunter trug, zurecht, zupfte die Ärmel seines Sweatshirts glatt und folgte Steffens auf dünnen Socken über kalte Fliesen ohne jede Eile ins Haus.
Steffens war nicht schwer zu finden. Von Thien musste lediglich den klappernden Geräuschen nachgehen, die aus einer Tür rechts im Hausflur zu ihm drangen. Der Gesuchte stand in der Mitte einer ungewöhnlich geräumigen Küche mit Delfter Kacheln an den Wänden. Ein gewaltiger Küchenblock mit einer mindestens fünf Zentimeter dicken Holzarbeitsplatte und integriertem Gasherd füllte die Mitte des Raumes.
»Bin gerade beim Marmeladekochen«, brummelte der Hausherr unsinniger Weise, denn das war angesichts des dampfenden Topfes, der auf nasse Tücher gestellten leeren Einmachgläser und eines großen Haufens geleerter Obstschalen mehr als offenkundig. Die feuchtwarme Luft war trotz des geöffneten Fensters gefüllt von einem intensiven süß-säuerlichen Geruch nach Frucht und Gelierzucker.
»Aha«, kommentierte von Thien daher diese Selbstverständlichkeit nur knapp, was sein Gegenüber jedoch als Aufforderung zu nehmen schien, ein paar weitere Erklärungen nachzuschieben.
»Ist gerade die heiße Phase, da kann ich nicht einfach mit Rühren aufhören. Hab mir ein paar Stiegen Erdbeeren vom Festland mitgebracht. Das hier sind die letzten.«
Von Thien hörte sich die Erklärung kommentarlos und ohne jedes Interesse an. Steffens war Hardliner in Sachen „Autofrei“, das wusste von Thien. Er fuhr wie viele andere Insulaner regelmäßig zum Einkaufen aufs Festland. Meistens nach Niebüll. Doch anders als andere, benutzte er dafür kein Auto. Er hatte gar keins. Er nahm seine asiatischen Vorbildern nachempfundene Fahrrad-Rikscha mit rüber, die von Thien ihm besorgt hatte. Sie fasste schier unglaubliche Mengen an Einkaufsgütern. »Wozu brauchts Autos, wenn man stramme Waden hat«, war sein Leitspruch.
Von Thien hatte sich ebenfalls so eine Rikscha anfertigen lassen, war selbst aber weit weniger dogmatisch eingestellt. Auf Amrum wollte und brauchte er kein Auto. Daher sollte hier am besten auch niemand anderes eines haben. Aber sobald er das Festland betrat, änderte sich seine Einstellung. Seine Mercedes-Limousine stand auf dem Inselparkplatz von Dagebüll immer für ihn bereit. Er hatte sie bewusst und voller Freude dem Klischee eines stinkreichen Unternehmers entsprechend gewählt. Auf sie würde er nie im Leben verzichten.
Die beiden Männer standen schweigend in der Küche. Der eine im Topf rührend, der andere regungslos und mit hochrotem Kopf.
»Was willst du?«, blaffte Steffens schließlich seinen Besucher an.
»Die Polizei war bei mir«, brüllte der zurück.
»Ja und? Was hat das mit mir zu tun?«
»Es wurden Autoreifen zerstochen, Autos zerkratzt, Scheibenwischer abgebrochen. Hier auf der Insel. Alles auswärtige Nummernschilder. Klingelt da was bei dir?«
»Was soll da bei mir klingeln? Klingt nach ner guten Aktion.«
»Fand die Polizei gar nicht. Sie meint, wir stecken dahinter. Amrum autofrei. Insbesondere ich als Vorsitzender.«
»Tust du aber wohl nicht, eh? So was traut sich der Herr Diplomingenieur a.D. ja gar nicht.«
»Der Herr Gar-nicht-so-ade-Diplomingenieur gewiss nicht. Der Herr Gewiss-und-wahrhaftig-ade-Oberstudienrat aber wohl schon. Oder seh ich das falsch?«
Auf von Thiens rundem, fülligem Gesicht hatte die Wutröte mittlerweile die Sonnenbräune übertönt. Das aufsteigende Blut hatte auch die prägnanten Lachfältchen um die Augen herum geglättet. Das zeigte bildhaft deutlich: In diesem Moment war Schluss mit lustig.
»Mann, das ist Vandalismus, das ist Terrorismus, das ist Anarchie! Damit haben wir im Verein nichts am Hut«, brüllte er los.
»Ach, haben wir nicht?«, entgegnete Steffens vollkommen ungerührt in provozierend ruhigem Ton. »Und wer, meinst du, bestimmt das? Immer nur hübsch die Plakate hochhalten und ja keinen stören? Dann haben wir die Stinker auch in hundert Jahren noch auf der Insel, Herr Vorsitzender. Da kannst du deinen Kram genauso gut gleich einpacken und dich vom Acker machen.«
»Steffens, du spinnst! Wir sind doch keine Randalierer; nicht so zumindest. Wir sind anständige Bürger, vergiss das nicht. Oder willst du noch deine Pension riskieren wegen so nem Rabaukenscheiß. Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Pension riskieren? Wegen ein bisschen Sachbeschädigung? Da glaub mal dran in unserem Rechtsstaat. Von anständigen Bürgern wie uns verlangen die doch schlimmstenfalls Schadensersatz. Außerdem kannst du doch nicht im Ernst glauben, dass ich das war – und wenn ich’s gewesen wäre, dass mir das irgendeiner nachweisen könnte.«
»Aber du warst es! Wenn nicht mit eigener Hand, dann doch als Anstifter. Als Vorsitzender unseres Vereins untersage ich dir hier und jetzt ganz ausdrücklich, so etwas jemals wieder zu tun. Es sei denn, ich ordne das an.«
Bodo von Thien brüllte mittlerweile in voller, durchaus imposanter Lautstärke, aber Johann Steffens ließ sich davon in keiner Weise beeindrucken. Unverdrossen rührte er seine Marmelade, fächerte sich gelegentlich den Duft zu, prüfte die Konsistenz. Und sagte erst einmal gar nichts mehr. Schließlich nahm er zwei gehäkelte Topflappen von einem Haken und stellte den riesigen Topf auf einen Untersetzer neben die Einmachgläser. Mit einer Kelle füllte er ein Glas nach dem anderen mit Marmelade. Kein einziger Tropfen ging daneben. Seine Ruhe brachte den Vereinsvorsitzenden komplett aus der Fassung.
»Steffens, wenn du mich nicht ernst nimmst und wenn du diese Sachen nicht sein lässt, schmeiß ich dich raus. Glaub’s mir! Dann bist du raus aus Autofrei.«
»Nun fahr mal ein paar Takte runter, von Thien«, forderte Steffens ruhig und mit kränkend verächtlichem Blick. »Erstens kannst du mich gar nicht rauswerfen. Ich bin als dein Stellvertreter gewählt und könnte allenfalls selber zurücktreten – lies mal deine Satzung – oder von einer Mitgliedermehrheit des Amtes und der Mitgliedschaft enthoben werden. Das wird beides nicht passieren, darauf kannst du Gift nehmen. Eher wackelt dein Stuhl. Zweitens waren solche Aktionen längst überfällig. Und drittens«, nun lächelte er süffisant, »glaubst du doch nicht im Ernst, dass ich als ehrenwerter Bürger und Staatsbeamter rumrenne und Autoreifen zersteche.«
»Nicht selber, vielleicht. Sag ich doch. Aber der geistige Brandstifter bist doch du, oder etwa nicht?«
»Ach, und wo soll ich geistig gezündelt haben?«
»Harmsen-Gang? Die Handschrift sieht doch verdammt nach Rolf, Krischan und Ole aus. Dumpfe Gewalt haben die prima drauf. Aber pass auf, was du da tust. Immerhin bin ich es, der die drei bezahlt.«
»Und ich bin es, der ihnen die Aufträge gibt und die Ausführung überwacht. Schon immer. Oder hast du das etwa vergessen? Außerdem: Zerstochene Reifen und zerkratzter Lack sprechen eine klare Sprache. Hat am Hamburger Flughafen ja auch funktioniert.«
»Ach daher weht der Wind; ich fasse es nicht!« Bodo von Thien schüttelte entsetzt den Kopf. »Mann, Mann, Mann, Steffens. Lass den Scheiß, sag ich dir noch mal in aller Deutlichkeit. Vorhin bei der Polizei habe ich erst mal die Klappe gehalten. Aber wenn das noch mal passiert, liefere ich dich denen ans Messer.«
»Pass du lieber auf, dass dich kein Messer trifft«, brüllte Steffens zurück und drehte die Schraubverschlüsse auf die gefüllten Marmeladengläser. »Und jetzt sieh zu, dass du aus meiner Küche verschwindest.«
– 4 –
Hark Petersen stand an der Reling und ließ sich die feinen Wasserperlen des Nieselregens ins Gesicht blasen. Es war nass, aber nicht wirklich kalt. Der Kriminalhauptkommissar und Leiter der Mordkommission Nord war bester Dinge. Drei freie Tage auf Amrum lagen vor ihm, und obwohl es im Moment noch nicht danach aussah: Schon in wenigen Stunden und das ganze Wochenende über sollte es überwiegend sonnig und weitgehend trocken werden.
Petersen hatte die Ecofare-Fähre von Dagebüll aus genommen. Sie war schnell, sehr schnell sogar. Keine halbe Stunde hatte sie bis Wyk auf Föhr gebraucht, wo sie vor wenigen Minuten wieder abgelegt hatte. In 20 Minuten sollte sie bereits in Wittdün auf Amrum festmachen. Der Kommissar war sich nicht ganz sicher, ob ihm dieses Tempo wirklich gefiel. Das ruhige Dahingleiten der Autofähre war ihm eigentlich viel lieber auf dem Weg zu seiner zweiten Heimat Amrum. Trotzdem hatte er sich, wie immer mehr Menschen auf ihrem Weg durchs Wattenmeer, für das mit Wasserstoff angetriebene Schiff der Ecofare-Gesellschaft entschieden. Diese Schiffe fuhren den ganzen Tag über im Stundentakt, so war man extrem flexibel. Und sie waren absolut emissionsfrei. Aus ihrem Schornstein, der sich nur noch pro forma so nennen konnte, kam reiner Wasserdampf. Von Dieselschwaden keine Spur.
Petersen war der einzige Passagier, der sich zurzeit hier draußen aufhielt. Alle anderen hatten im Inneren des Schiffes Schutz vor dem kräftigen, nassen Wind gesucht. Viel zu sehen war bei diesem diesigen Wetter ohnehin nicht. Der Strand von Wyk, zu dem sie gerade parallel auf der Norderaue entlangpflügten, ließ sich eher erahnen als wirklich sehen.
Seine Reisetasche, die alles enthielt, was er für die nächsten drei Tage brauchen würde, hatte der Kommissar zu seinen Füßen abgestellt. In den dafür vorgesehenen Borden im Schiffsinneren konnte er sie nicht lassen, denn er hatte diesmal auch seine Dienstwaffe darin. Sie mitzunehmen war vorschriftswidrig, das war ihm bewusst. Er hatte lange gezögert, es zu tun, sich dann aber doch dafür entschieden. Einfach aus einem Gefühl heraus. Bei seinem Kurzurlaub auf Amrum vor drei Wochen hatte er sie zuhause im Safe gelassen und sich auf der Insel dann unvermittelt und unbewaffnet einem vermeintlichen Profikiller gegenübergesehen. Das würde sich diesmal natürlich nicht wiederholen; vermutlich würde es sogar sein ganzes Leben lang nicht wieder vorkommen. Das war ihm vollkommen bewusst. Aber trotzdem: Irgendetwas in ihm rief danach, die Waffe einzupacken.
Die Fähre hatte inzwischen den schützenden Windschatten der Insel Föhr verlassen. Die See wurde rauer. Zum Sprühregen gesellte sich jetzt die hochspritzende Gischt der mit imposanter Kraft heranrollenden Wellen. Immer dichtere Vorhänge aus Wasser setzten an, seine dunkelblaue Regenjacke zu durchdringen. Der Kommissar entschied sich nun lieber doch, wie all die anderen Schutz im Bauch des Schiffes zu suchen, bevor seine Jeans endgültig durchweicht sein würde. Außerdem hatte er Lust auf Kaffee. So griff er sich die Tasche und ging hinein.
Drinnen gab es eine Servicestation mit Snacks und Getränken und einem kleinen Tresen davor, der hier Bar und Ticketverkauf in einem war. Er streifte die Kapuze von seinem lockigen, dunkelbraunen und von zunehmendem Grau aufgehellten Haar. Seit etlichen Wochen war er nicht mehr dazu gekommen, es schneiden zu lassen. Oder, besser gesagt, hatte ihm die Lust dazu gefehlt, einen Friseurtermin auszumachen. So näherte er sich langsam einem Siebzigerjahre-Look. Das wenigstens hatte sein bester Freund, Oberstaatsanwalt Redlef Maier, schon letzten Sonntag bei einem gemeinsamen Mittagessen behauptet. Und Redlefs Freundin Beatrice und Harks Frau Freddy hatten zustimmend gegrinst. Zumindest nahm er an, dass ihr schweigendes Lächeln Zustimmung bedeutet hatte.
Bei dem jungen Mann hinter dem Tresen, der hier als Steward, Fahrkartenverkäufer und Decksmann in einem fungierte, bat er um einen doppelten Espresso mit einer dreifachen Portion Zucker.
»Der geht aufs Haus, Herr Kommissar«, sagte eine junge, freundlich-fröhliche Stimme neben ihm, als er sein Portemonnaie aus der Tasche zog.
Überrascht blickte Petersen in die Richtung, aus der die Stimme kam, während er gleichzeitig, ohne auf die Einladung einzugehen, vier Euro aus der Geldbörse nahm und sie mit einem freundlichen »stimmt so« zum Servicemann hinüberschob. Der schob, ebenso lächelnd, das Geld zurück und zuckte entschuldigend mit den Schultern. Die Einladung, die da soeben ausgesprochen worden war, schien für ihn einem Befehl gleichzukommen.
»Kennen wir uns?«, fragte Petersen und musterte die junge Frau, die sich neben ihm an den Tresen gestellt hatte. Sie war jung, vermutlich noch keine dreißig. Der Kleidung nach war sie eher auf Geschäftsreise als im Urlaub.
»Caroline Weiland«, stellte sie sich vor und hielt ihm mit einer übertrieben zackigen Bewegung und einem eher routiniert als herzlich wirkenden Lächeln die Hand hin.
Offenkundig erwartete sie, dass ihm der Name etwas sagt. Das tat er aber nicht. Er drückte kurz und unverbindlich ihre Hand – sie war weit wärmer als seine im Freien abgekühlten Finger – und zog dabei fragend die Augenbraue hoch.
»Tut mir leid, Frau Weiland. Müsste ich Sie kennen?«
»Den Namen vielleicht, das Gesicht nicht. Ich arbeite für die Sicherheitsabteilung von Ecofare. Wir haben vor gut drei Wochen mal telefoniert, und Sie haben mir per Handy ein Foto von sich und Ihrem Dienstausweis geschickt. Zur Legitimierung. Darum habe ich Sie erkannt.«
»Ah, ja«, sagte Petersen nur. An das Gespräch erinnerte er sich durchaus. Es war nicht sonderlich erfreulich gewesen und somit keine angenehme Erinnerung. Er würde sich nicht dafür entschuldigen, sich ihren Namen nicht gemerkt zu haben.
Von seiner wenig freundlichen Haltung ungerührt, plapperte die Frau munter und offenkundig stolz über ihre Arbeit drauf los.
»Ich bin auf Inspektionsreise, wissen Sie. Ich muss auf unseren Fähren, bei den Bahnen und bei unseren Logistikern die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften kontrollieren. Auch im Haus von unserem Ober-Ober-Boss auf Amrum. Das kennen Sie ja auch sehr gut, nicht wahr? Und die Treffen mit Geschäftspartnern auf Amrum absichern. Das gehört alles dazu. Kommissarisch erst mal nur, aber wer weiß… Hat früher alles mein Chef gemacht, der ja nun nicht mehr da ist.«
»Aber auch das wissen Sie ja besser als jeder andere«, schob sie mit einem vielsagenden, anbiedernden Blick hinterher.
Petersen ging nicht darauf ein. Aber ein kleines Detail in ihrem Redeschwall hatte doch sein Interesse geweckt.
»Geschäftspartner auf Amrum?«, hakte er nach.
»Ähm, ja.« Sie kam ins Stottern, wünschte sich augenscheinlich, das lieber nicht erwähnt zu haben. »Ja, das auch. Gehört alles zum Job«, fuhr sie ausweichend fort.
»Was sind denn das für Partner?«, bohrte er nach.
»Ja, nun, Geschäftspartner halt.« Die junge Frau hatte einen hochroten Kopf bekommen.
»Aha, und was für Geschäfte?«
»Naja, Sie wissen schon: Die Wasserstofftankstelle, die wir dort betreiben, der Anleger, die Kunden für unsere Logistikangebote…« Das Rot hatte sich zur normalen Gesichtsfarbe zurückverwandelt, die Frau sprach wieder klar und flüssig. Sie hatte, wie der Kommissar mit beruflicher Routine sofort bemerkte, ein unverfängliches Fahrwasser erreicht, das fern von dem war, über was sie unüberlegt geplappert hatte.
Wären sie im Kommissariat gewesen und dies ein Verhör, hätte er sie jetzt in die Mangel genommen und spätestens nach zwei Stunden gewusst, wen und was sie wirklich mit dem Wort „Partner“ gemeint hatte. Hier aber, im privaten Umfeld und bei einem Thema, das ihn nicht wirklich etwas anging, nahm er ihre Antwort mit einem leidenschaftslosen »Ah, ja« entgegen.
»Und Sie? Was treibt Sie heute nach Amrum?«, fragte die junge Frau und schob sich unangenehm nah an ihn heran. »Hat es neue Morde gegeben, Herr Kommissar, oder sind Sie hier zum Entspannen?«
Ihre Handfläche legte sich, während sie sprach, sanft auf seinen Oberarm. Ihre Stimme wurde anbiedernd.
»Bleiben Sie über Nacht?«, hauchte sie.
Petersen war weit davon entfernt, verunsichert zu sein. Aber er war peinlich berührt. Diese unbekannte und sicherlich fünfzehn Jahre jüngere Frau schien ihn anzuflirten – völlig unvermittelt und zudem auf eine sehr unangenehme, aufdringliche Art. Er hatte nicht die geringste Lust, sich dem auch nur eine Sekunde länger auszusetzen.
»Ich geh dann mal wieder nach draußen«, sagte er mit eisiger Miene, trat einen Schritt zurück und schob dabei sacht ihre Hand zur Seite. »Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit auf Amrum.«
Dann griff er sich seine Tasche und ging in Richtung Außendeck.
»Ihr Geld…«, rief der Mann am Service ihm nach.
Petersen hob seine Hand und schwenkte sie grüßend in der Luft, ohne sich umzudrehen. Dann war er draußen und lehnte sich, wie zuvor, an die Reling. Es hatte aufgehört zu regnen, die Luft war klar und rein, die Sicht gut, und im Nordwesten rissen bereits die Wolken auf. Die Sonne kam heraus. In fünf Minuten würde die Fähre und vielleicht auch schon die Sonne den Anleger Wittdün erreicht haben.
– 5 –
Christiano Rodriguez Querra da Silva war äußerst schlechter Laune. Das kam bei dem Leiter der Amrumer Polizeidienststelle, der auf der Insel meist nur mit „Tiano“ und niemals mit seinem vollen Namen angesprochen wurde, eher selten vor. Normalerweise war er der Inbegriff von Freundlichkeit, Ruhe und Gelassenheit. Aber normalerweise bekam er auch keine Dienstanweisungen direkt aus dem Landespolizeiamt in Kiel. Schon gar nicht solche, die derart in seinen Dienstalltag und seine Beziehung zu den anderen Inselbewohnern eingriffen. Ihm waren »dauerhafte, flächendeckende, systematische und erfolgsorientierte Geschwindigkeitsüberwachungen« auf Amrum aufgetragen worden.
„Erfolgsorientiert“, das hatte man ihm mündlich klargemacht, hieß dabei nicht, Geschwindigkeitsüberschreitungen zu verhindern, sondern möglichst viele Knöllchen zu verteilen. Sein Gegenargument, dass er dafür weder das Personal noch die technische Ausstattung habe, wurde mit ungewöhnlicher Freigiebigkeit vom Tisch gewischt: Ihm wurden sofort zwei zusätzliche Polizeimeister-Anwärter mitsamt zweier mobiler Radaranlagen auf die Insel geschickt. So war er nun schon seit fast vierzehn Tagen im Dauereinsatz dabei, sich alle Autofahrer der Insel zum Feind zu machen.
Zu den ersten Opfern seiner Radarfallen hatte ausgerechnet Tianos eigene Mutter gehört. Vor den Augen und Ohren des schnöselig-dummen Polizeimeister-Anwärters Gerald hatte sie ihrem brasilianischen Temperament, das in all den Jahrzehnten in Deutschland nichts an Spritzigkeit eingebüßt hatte, freien Lauf gelassen. Minutenlang schimpfte sie auf ihren bald 50 Jahre alten Sohn ein. Zum Glück allerdings weitgehend auf Brasilianisch, das weder der junge Kollege noch Tiano selbst verstand. Erst nach Minuten gelang es Tianos Vater, seine Gattin in den Wagen zurückzudrängen und mit einem schiefen Lächeln das Knöllchen vom Sohn in Empfang zu nehmen.
Am Abend, bei einem Glas Rotwein, hatte der Vater den Sohn dafür gelobt, die Anweisungen seines Dienstherren wortgetreu umzusetzen, und ihn ermutigt, dies auch weiterhin zu tun, selbst wenn ihm das den Hass aller Insulaner einbringe.
»So gehört sich das für einen deutschen Beamten«, betonte der gebürtige Spanier.
Dann drückte er seinem Sohn das Knöllchen mit den Worten in die Hand »Aber das wirst natürlich du für deine alten Eltern bezahlen«.
Der Nieselregen hatte inzwischen nachgelassen, und die Sonne brach durch. Tiano stand, wieder einmal, ein paar hundert Meter von der Radarfalle entfernt bereit, mit seiner Kelle auf die Straße zu hechten, wenn die Kollegen vorne eine Geschwindigkeitsüberschreitung meldeten. Nach zwei Wochen Dauereinsatz an ständig wechselnden Orten – im Moment stand er in der Einfahrt zum Süddorfer Gewerbegebiet hinter einer langgezogenen Kurve in Fahrtrichtung Nebel – hatten die Kontrollen allerdings ihre Wirkung gezeigt. Seit ein paar Tagen kam ihnen kaum noch jemand aufs Foto. Die Einheimischen waren gewarnt und fuhren nun überwiegend vorschriftsmäßig. Die Auswärtigen hielten sich schon immer mehrheitlich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, solange sie auf der Insel waren. Da kam es nun eigentlich höchstens noch vor, dass jemand vor sich hin träumte und die Gebotsschilder am Straßenrand dabei schlichtweg übersah.
Das bedeutete nun aber auch, dass Tiano und die Kolleginnen und Kollegen sich hier völlig umsonst die Beine in den Bauch standen, während andere Aufgaben unerledigt blieben. Einerseits freute sich Tiano natürlich darüber, dass er niemandem einen Strafzettel verpassen musste. Andererseits… nun ja, wenn man so eine Arbeit nun schon mal machte, wollte man doch eigentlich auch Erfolge sehen, gestand er sich ein und war von der eigenen Unvollkommenheit peinlich berührt.
Sie hätten zurzeit auch ohne diese Geschwindigkeitskontrollen wirklich mehr als genug an der Hacke gehabt. Der Autovandalismus, der in dieser Woche einen traurigen Höhepunkt erreicht hatte, schrie danach, aufgeklärt zu werden. Am Vormittag hatten sie obendrein noch bei einer „Fridays for Future“-Demonstration in Wittdün die Staatsmacht repräsentieren müssen. Morgen würden sie die inzwischen ebenso obligatorische „Samstag gegen Autos“-Demo von „Amrum autofrei“ zu begleiten haben.
Dabei war zu allem Überfluss schon zum zweiten Mal eine Gegendemonstration des neu gegründeten Vereins „Freie Fahrt Amrum“ angesagt. Die beiden gegnerischen Gruppen hatten sich in den letzten Wochen verbal und teilweise auch schon handgreiflich aufeinander eingeschossen. Daher war für morgen mit offener Gewalt oder vielleicht sogar einer Massenschlägerei zu rechnen. Zwei Mannschaftstransporter voller Bereitschaftspolizisten würden die Inseltruppe beim Aufrechterhalten der Ordnung unterstützen. Tiano konnte sich nicht erinnern, dass es so etwas jemals zuvor auf seiner Insel gegeben hätte.
»Schwarzer Mustang mit 95«, riss ihn Leif Hansens Stimme durch das Funkgerät aus seinen Gedanken.
Der Polizeimeister stand an der Messstation, die sie in der 50er-Zone in Höhe der Wittdüner Vogelkoje gegenüber dem Zeltplatz aufgebaut hatten.
»Hat jetzt 112 drauf«, meldete sich Sekunden später Kollegin Emma Jordan von der zweiten Radarfalle in der 70er-Zone im Wäldchen hinter dem Leuchtturm.
Sie hatten diese ungewöhnliche doppelte Radar-Staffelung in dem Versuch aufgebaut, vertraute Muster zu durchbrechen und doch mal wieder Beute nach Kiel melden zu können.
Tiano sprang mit seiner Kelle auf die Straße und stellte sich dem Ford entgegen, der auf der langen Geraden hinter der Kurve beängstigend schnell herangebraust kam. So ganz wohl war ihm dabei nicht, und er machte sich darauf gefasst, blitzschnell zur Seite springen zu müssen. Aber der Mustang-Fahrer legte leicht schlingernd eine beachtliche Vollbremsung hin. Eine schwarze, nach verbranntem Gummi stinkende Rauchwolke zog sich hinter dem Fahrzeug her, dicht wie bei einer startenden Rakete. Die Reifen malten eine fast 100 Meter lange schwarze Doppel-Schlangenlinie auf den Asphalt.
Gute zehn Meter vor dem Polizeibeamten kam der Wagen zum Stehen und holperte dann im Schritttempo auf abgeriebenen Gummis auf ihn zu. Tiano winkte den Fahrer mit gebieterischer Geste an den Straßenrand.
»Rolf Harmsen, das hätte ich mir ja denken können«, murmelte der Polizeihauptkommissar mit eisigem Gesichtsausdruck in sich hinein, als der Fahrer das Seitenfenster herunterließ.
»Mensch, Tiano, was’n das für ne Scheißaktion«, beschwerte sich Harmsen und streckte den Kopf aus dem Fenster. »Haste echt Schwein, dass ich fahrn kann, da wärste jetzt sonst platt. Aber die Reifen musste mir zahlen, die sind Schrott.«
»Führerschein und Fahrzeugschein, bitte«, konterte der Polizist ungerührt mit weiterhin frostiger Miene.
Polizeimeister-Anwärter Gerald hatte sich mittlerweile auf die Beifahrerseite gestellt und die Hand nah ans Pistolenholster gelegt. Er blickte beeindruckend grimmig drein.
»Ausnahmsweise mal eine vernünftige Aktion«, dachte sein Chef, »aber wir sind hier ja nicht in der Großstadt.«
Er hoffte inständig, dass der begriffsstutzige junge Kollege keinen Unfug mit der Waffe anstellen würde.
Tiano schaute in den Wagen. Wie er erwartet hatte, erblickte er dort Krischan und Ole, die ständig wie Schatten an ihrem Boss Rolf Harmsen klebten. Ihre Nachnamen hatte man auf der Insel längst vergessen. Wenn es zusätzlich zum Vornamen eine genauere Bezeichnung brauchte, dann lautete sie „von der Harmsen-Gang“.
Ole „von der Harmsen-Gang“, der auf der Rückbank saß, warf hastig seine Jacke über den freien Platz neben sich, als er den Blick des Polizisten bemerkte. Allerdings vergebens. Der hatte längst gesehen, was dort lag.
Tiano griff sich, ohne den Blick von Ole zu wenden, die Papiere, die Rolf Harmsen ihm mit lässiger Geste durch das Fenster entgegenstreckte.
»Die bleiben erst mal bei uns«, sagte er, und steckte sie ohne einen weiteren Blick darauf ein. »Und nun mal bitte alle aussteigen.«
Die drei rührten sich nicht. Innerlich fluchte Tiano, dass er den drei inselbekannten Raufbolden in diesem Moment nur mit dem unerfahrenen Gerald gegenüberstand und nicht mit Leif oder zumindest der Kollegin oder dem Kollegen von der Saison-Besetzung. Äußerlich ließ er sich jedoch nichts anmerken, sondern verkörperte mit jeder Faser seines Körpers die unerschütterliche Autorität des lokalen Polizeichefs.
»Raus«, knurrte er. »Jetzt!«
»He, nu mal halblang«, beschwerte sich Harmsen, aber der Polizist bedeutete ihm mit klarer Geste, seinem Befehl endlich Folge zu leisten und nicht zu diskutieren.
Der Fahrer fügte sich seufzend drein, und auch Ole, den Tiano unablässig im Auge behielt, machte zum Glück keinerlei Anstalten, unter die Jacke neben sich zu greifen. Vielmehr quetschte er sich von der Rückbank des alten, aufgemotzten Zweitürers nach draußen, nachdem Kumpel Krischan ausgestiegen war.
Der Polizist dirigierte den Fahrer, der doch tatsächlich ansetzte, den Zustand der Reifen zu begutachten, unwirsch zu seinen Begleitern an den Straßenrand.
»Alle umdrehen und Hände aufs Autodach«, befahl er, und an seinen Kollegen gewandt »Nach Waffen abtasten«.
Dann griff er sich das Funkgerät: »An alle, ich brauch euch hier. Macht schnell.«
Die Kollegen an den Radarstationen waren zu Fuß. Trotzdem dauerte es keine drei Minuten, bis Leif Hansen, der an der ersten Radarfalle stationiert war, neben ihm stand. Der junge Polizeimeister, der im vergangenen November der Liebe wegen von der Husumer Mordkommission zur Inselpolizei gewechselt war, war offenkundig sofort losgespurtet. Er hatte »macht schnell« als dringlichen Hilferuf aufgefasst und in seinem 1000-Meter-Lauf sogar noch die Kollegen von der zweiten Station überholt. Dabei atmete er nicht einmal sonderlich schwer, und auf seinen fragenden Blick hin bedeutete Tiano ihm »Behalt die Bande hier im Auge«. Dann zog er sich Schutzhandschuhe an und krabbelte von der Fahrerseite aus in den Ford.
»He, das darfsse ganich«, brüllte Harmsen sofort. »Da brauchst’n verdammten Durchsuchungsdings für.«
Wenn Ihnen dieser Einstieg gefällt und Sie den Küsten-Krimi als eBook für 4,99 Euro kaufen möchten, kommen Sie für Kindle hier auf die Amazon-Bestellseite.
Als Taschenbuch ist es im Buchhandel sowie bei Amazon verfügbar und kostet 11,90 Euro. Den den Taschenbuch-Kauf bei Amazon klicken Sie hier.